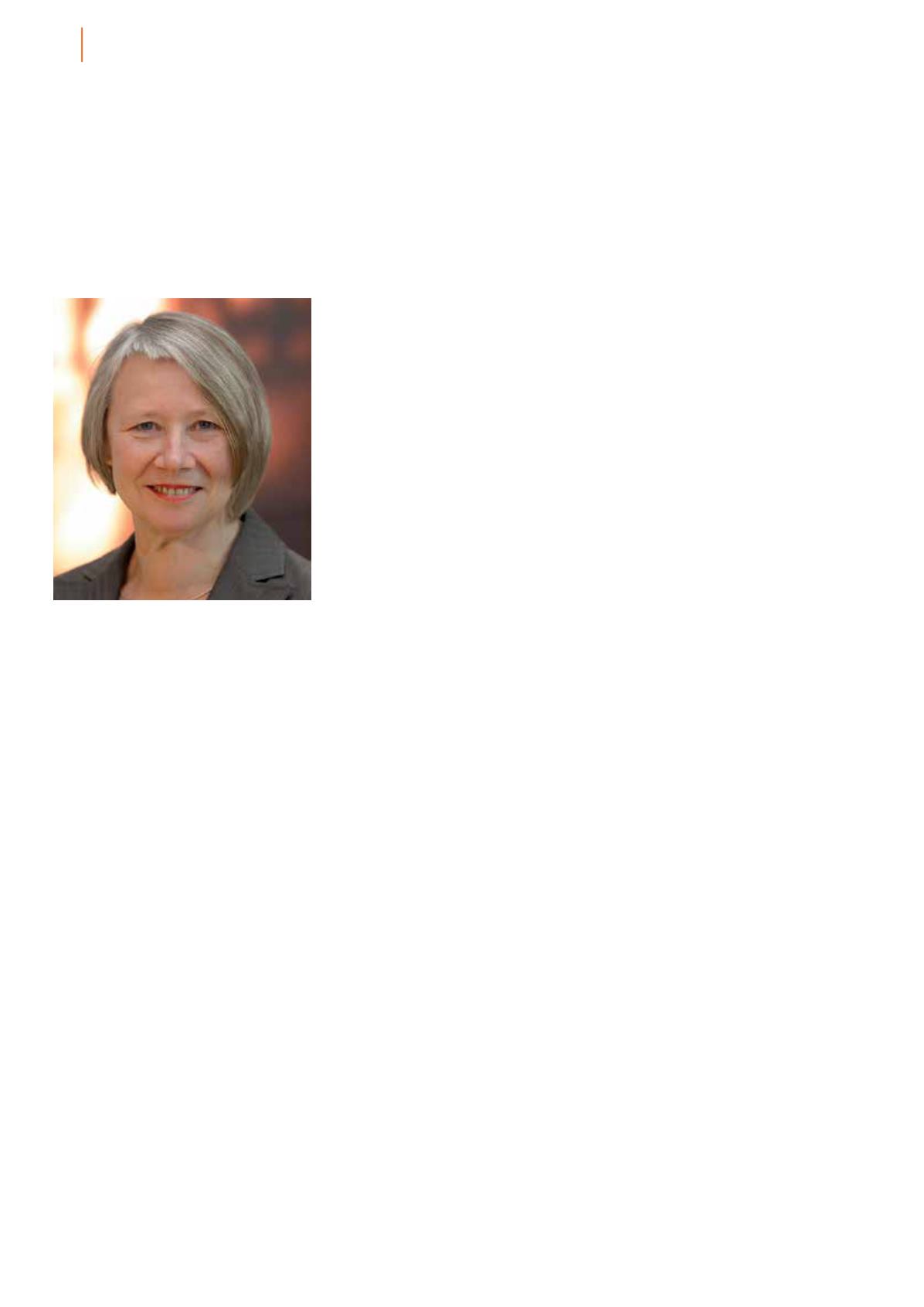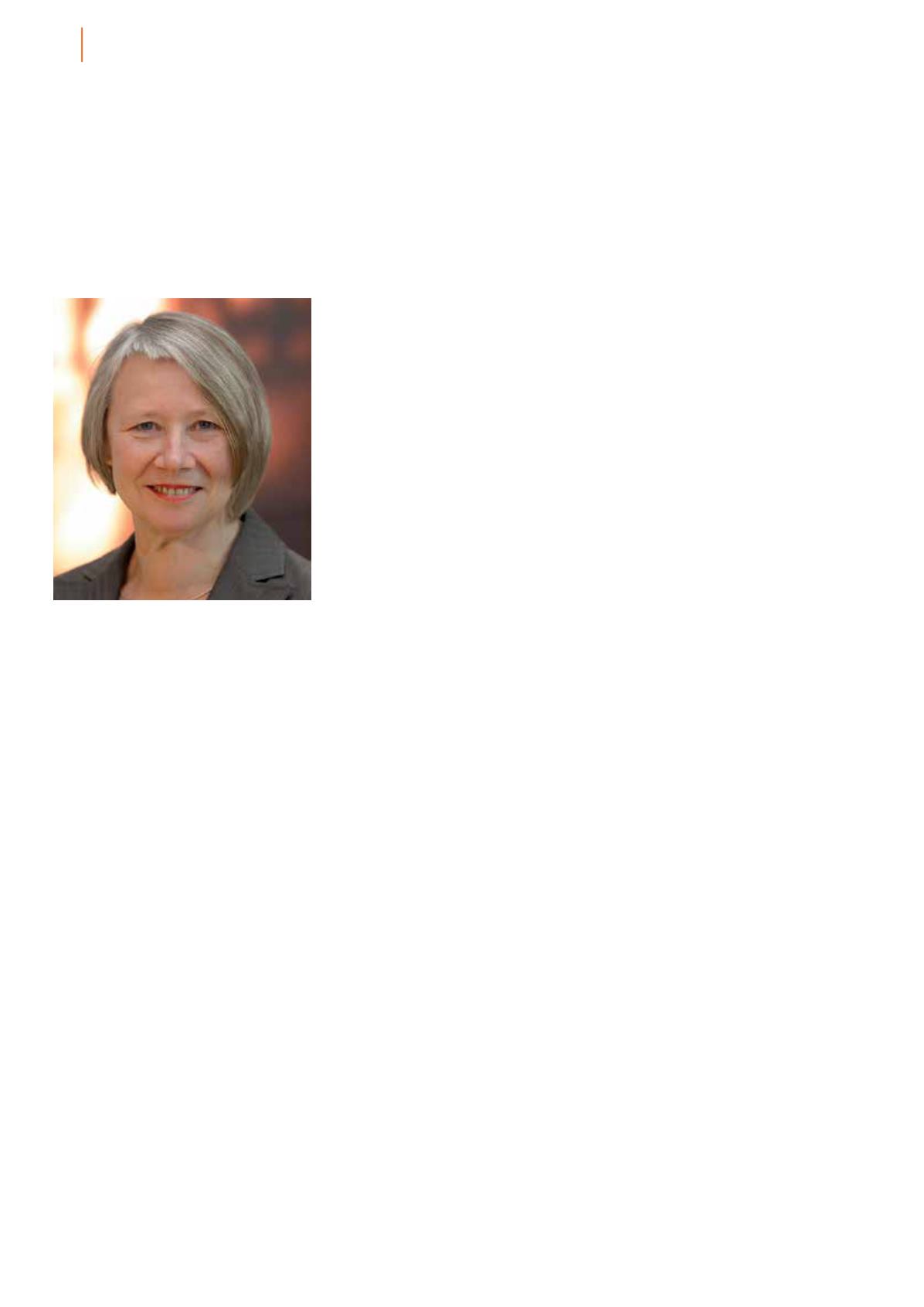
16
THEMA
interview mit barbara Haas zur Verantwortung des Arbeitgebers
Gesundheitsfördernde Rahmenbedingungen
die gesundheit von lehrerinnen ist nicht nur ein persönliches Problem der
einzelnen lehrkraft, sondern vor allem ein volkswirtschaftliches und bildungs
politisches Problem. Zahlreiche Studien haben immer wieder festgestellt, dass
arbeitsbedingter Stress ein wesentlicher grund für Erkrankungen ist.
bei der Wiederholung der Befragung, die nach
einigen Jahren geplant ist, durch intensivere
Unterstützung verbessert werden.
unterstützungsangebote bei der Auswer
tung der Schulberichte vor Ort und Prä
ventionsmaßnahmen kosten geld. Welche
Ressourcen wurden vom Kultusministerium
baWü dafür zur Verfügung gestellt?
Seit Langem sind in Baden-Württemberg die
Mittel für ArbeitsmedizinerInnen und jetzt auch
die Fachkräfte für Arbeitssicherheit im erforder
lichen Umfang eingestellt – nach der Vorschrift
2 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung.
Diese stehen und standen als Unterstützung
bereit. Auch die SchulpsychologInnen nahmen
sich des Themas bei Pädagogischen Tagen und
Fortbildungen an. Angebote des Betriebsärzt
lichen Arbeitsmedizinischen Dienstes (BAD)
können kostenlos für die Schulen abgerufen
werden. Was fehlt, ist die Unterstützung durch
ArbeitspsychologInnen.
Welche belastungen bzw. Anforderungen
bewerten die lehrkräfte in baWü als beson
ders hoch im Vergleich zu anderen berufs
gruppen und sind hierbei unterschiede zwi
schen den einzelnen Schulformen vorhanden?
Hier gibt es deutliche Ergebnisse: Emotio
nale Anforderungen und die Vereinbarkeit von
Arbeits- und Privatleben sind Belastungsspitzen
und beides Treiber für einen Burn-out. Äl
tere Lehrkräfte haben im Altersvergleich einen
schlechteren Gesundheitszustand als jüngere,
was nach einem Arbeitsleben im Stressberuf
„Schule“ nicht verwundert und Forderungen
nach Entlastungen für ältere Lehrkräfte un
terstützt. Die Unterschiede zwischen den Ge
schlechtern sind nicht signifikant, auch die
Schularten (-formen in NRW) unterscheiden
sich kaum. Insgesamt wurden den KollegInnen
ein hoher Einfluss auf die Arbeit und gute Ent
wicklungsmöglichkeiten attestiert.
Welche Konsequenzen hat die landesregie
rung baWü aus der gesamtauswertung gezo
gen und welche konkreten Präventionsmaß
nahmen sind in die Wege geleitet worden?
Auf Druck der GEW hat sich die Landesregie
rung bereits 2007 mit möglichen Präventions
maßnahmen befasst und 2011 drei Millionen
Euro zusätzlich für eine Palette von Maßnahmen
bereitgestellt. Es gibt das einjährige Konzept
„Lehrergesundheit als Führungsaufgabe“, eines
für BerufseinsteigerInnen, Angebote für Kolle
gInnen im mittleren Lebensalter, Kurse zur Res
source „Ich“ wie auch begleitende Workshops
und Fortbildungen für Schulen, die Maßnahmen
erarbeiten. Letztere müssen unbedingt verstärkt
werden, wie auch die Vereinbarkeit von Beruf
und Privatleben noch stärker in den Fokus der
Verantwortlichen gerückt werden muss. Derzeit
werden Schulen und Schulkindergärten nach
ihren Maßnahmen befragt und Gespräche mit
Schulen mit Belastungsspitzen geführt.
Was vermisst die gEW baWü bei den lehr
kräften in den Schulen und was bei der Kon
zeptionsentwicklung der landesregierung?
Gesundheit zum Thema zu machen ist insbe
sondere Sache der LehrerInnen an ihrer Schule.
Solange sie dieses ausblenden, weil die Zeit
dazu nicht da ist und alles andere wichtiger ist,
wird sich nichts bewegen. Die Konzeption für
die erneute Gefährdungsbeurteilung mit dem
COPSOQ-Fragebogen wird daher das Thema
„Motivation zur Befragung“ intensivieren.
Welche Forderungen werden von den Per
sonalräten konkret gestellt und welche An
regungen gibst du der gEW nRW für diesen
bereich?
Für die Wiederholung der Befragung wird
derzeit ein verbessertes Konzept entwickelt.
Die wichtigsten Forderungen bleiben: Vor der
Erhebung müssen Gesundheitstage in der
Region stattfinden sowie wirksame Unterstüt
zung und Zeit bereitgestellt werden. Arbeits
medizinerInnen und Fachkräfte für Arbeitssi
cherheit sollten in jede einzelne Schule gehen
und Hilfe anbieten. Zudem sind Workshops
für Maßnahmen an der Schule mit externer
Begleitung wichtig und auch die räumlichen
Voraussetzungen für gute Arbeit müssen ge
währleistet sein.
barbara, danke für die Schilderung der Er
fahrungen in baWü und deine Anregungen.
Das Interview für die nds führte Anne Ru ert.
Foto: Barbara Haas
Seit 2011 wird in NRW ein Fragebogen nach
COPSOQ-Standard zur Gefährdungsbeurteilung
verwendet, der zuvor in Baden-Württemberg lan
desweit zum Einsatz kam. Die nds hat dazu ein
Interview mit der ehemaligen stellvertretenden
GEW-Landesvorsitzenden und Vorsitzenden des
Hauptpersonalrats des Kultusministeriums Ba
den-Württemberg Barbara Haas geführt.
nds: Welche Probleme bei der beteiligung
und umsetzung haben sich in baden-Württ
emberg gezeigt und welche Erklärungszu
sammenhänge gibt es nach Auffassung der
Personalräte?
barbara Haas:
Es ist positiv hervorzuheben,
dass sich über 50 Prozent der LehrerInnen in
Baden-Württemberg (BaWü) – also rund 54.000
Lehrkräfte – an der Befragung zur Gefährdungs
beurteilung beteiligt haben. Das ist die bisher
weltweit größte Erhebung. Die Ergebnisse kön
nen somit nicht ignoriert werden. Dabei haben
SchulleiterInnen eine Schlüsselrolle. Sie wurden
im Vorfeld zu Informationsveranstaltungen ein
geladen. Zeigte sich hier bereits kein Interesse,
wurden die Kollegien nicht informiert. Das größ
te Problem war allerdings, dass die beteiligten
Schulen den anschließenden Schulbericht zwar
zur Kenntnis genommen haben, die Arbeit an
Maßnahmen zum Abbau der Gefährdungen
jedoch im Alltagsstress unterging. Das muss