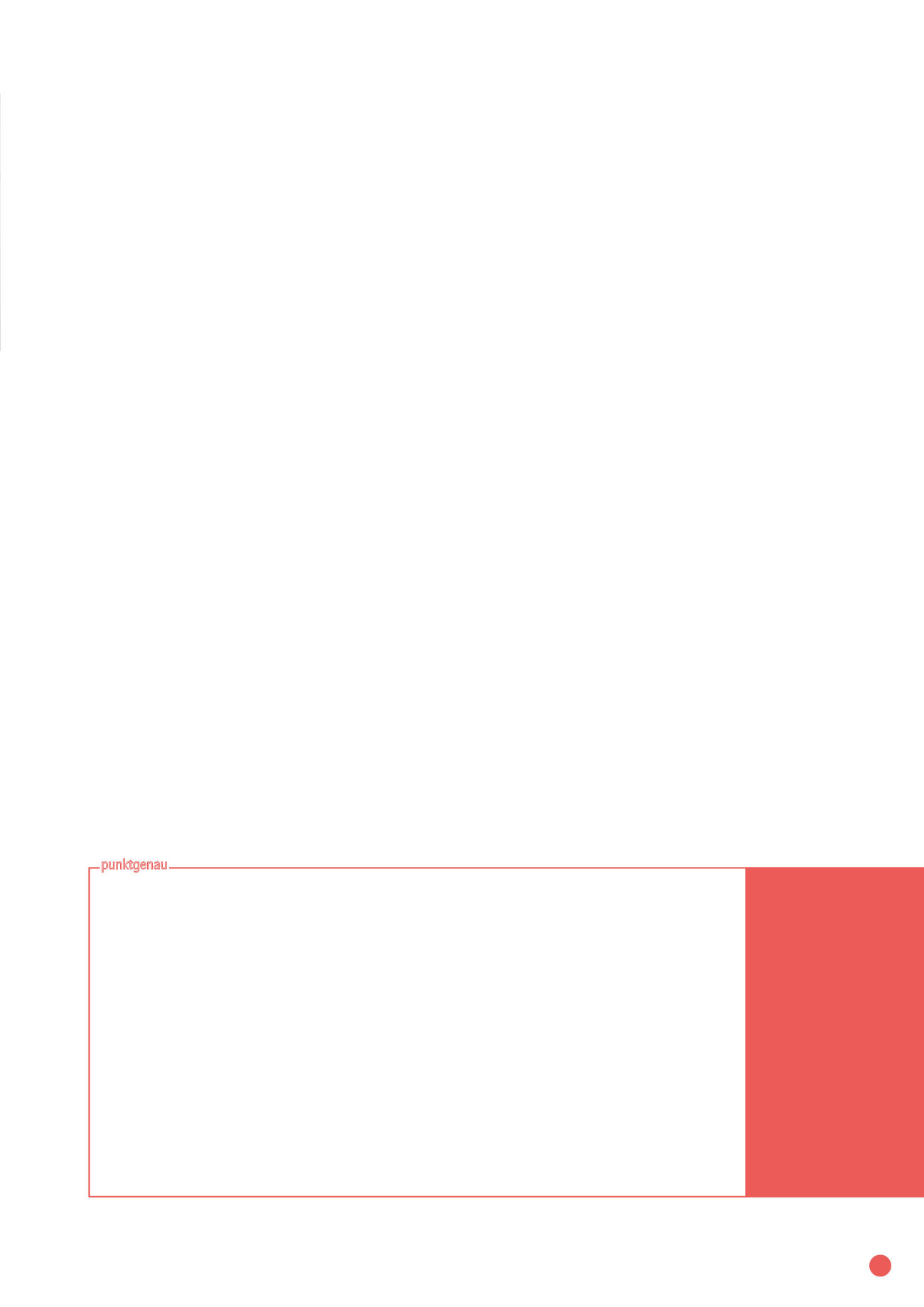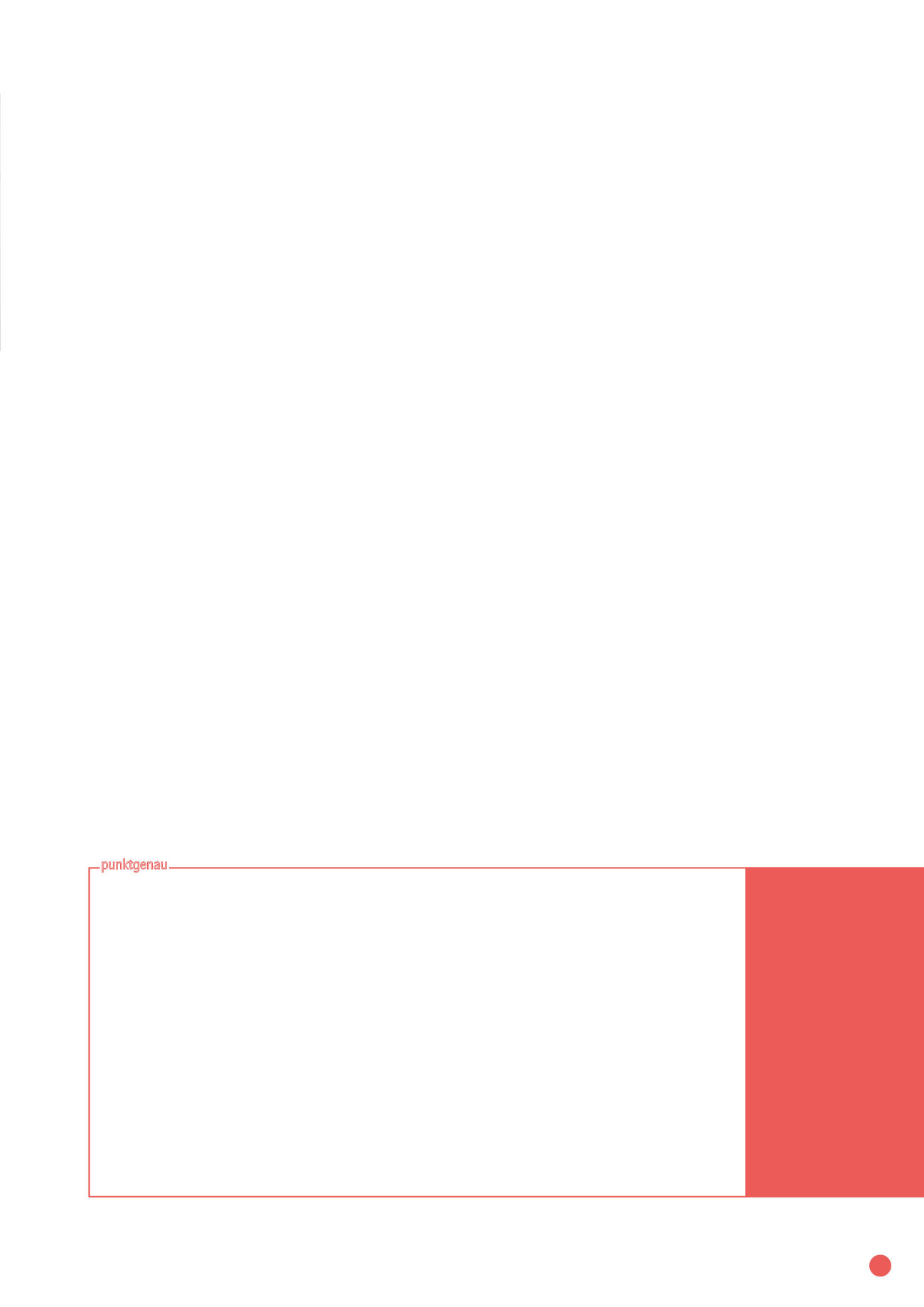
5
punktlandung2015.2
haben. Sie scheinen sich von Generation zu Generation
fortzusetzen. Dabei ist zu beachten, dass beklagende
Pädagoginnen von heute in den 1960er Jahren mögli-
cherweise selbst begeisterte Trägerinnen vonMiniröcken
und engen Jeans in der Schule waren. DasWiederkehren
ähnlicher Modephänomene im Schulkontext und die
Modebiografien heutiger Lehrender erfordern Blick- und
Perspektivenwechsel: Wie reagierten Eltern und LehrerIn-
nenauf eigene jugendkulturelleOutfits?WelcheMöglich-
keiten suchte undnutzteman selbst, um sich vomBeklei-
dungshabitus der Erwachsenengeneration abzugrenzen?
(Auch) eine Stylefrage: die eigeneGeschlechterrolle
A
uch genderreflexive Blicke auf die schulischen Beklei-
dungsphänomene sind sinnvoll. Denn andengenannten
Beispielen fällt auf, dass scheinbar nurweibliche Schüler-
körper provozieren,während sexualisierteOutfits von Jun-
gen – beispielsweise hautenge Muskelshirts – im schuli-
schenFeldnicht zurDiskussion stehen.Wiedas Londoner
Beispiel der 1960er Jahre zeigt, werden Jungen in Einzel-
fällen sogar als Schiedsrichter für die Einhaltung schick-
licher Bekleidungsregeln eingesetzt. Außerdem wird in
denDiskussionenwiederholt dasArgument eingeworfen,
dass die freizügigeKleidung von SchülerinnenMitschüler
vom Lernen abhalte und Lehrer provoziere.
I
n Schulen als Lern- und Aktionsorten des konstruktiven
Umgangs mit gesellschaftlicher und sozialer geschlecht-
licher Heterogenität müssten differenzierte Antworten
gesucht und soziokulturelle, vestimentäre Kompetenzen
entwickelt undpraktiziertwerden. Die Idee, Schülerinnen
übergroße T-Shirts zu verordnen, mit denen aufreizende
Outfits versteckt werden, scheint keine Lösung. Denn so
findet keine pädagogisch-didaktische Auseinanderset-
zung mit soziokulturellen Weiblichkeits- und Männlich-
keitskonstruktionen durch Bekleidung und Moden statt.
Ebenso bleibt eine Analyse der Hintergründe der Phäno-
mene und des Mode- und Schönheitshandelns von ado-
leszenten SchülerInnen aus.
D
ie großen und vielschichtigen Herausforderungen
von pubertierenden Mädchen und Jungen, ihre Körper
geschlechtlich neu bewohnen zu lernen und durch vesti-
mentäre Styles zu interpretieren, werden kaum pädago-
gischbedacht und curricular berücksichtigt. Hierwirddie
vielschichtige Bedeutung, die Kleidung bei der sozialen
und kulturellen Konstruktion von Geschlecht und auch
bei Prozessen jugendkulturellen Verortens hat, nicht be-
rücksichtigt. Für PubertierendeundAdoleszente sinddies
jedochexistenzielleProzesse, diegeradeauch imFeldder
Schule ausgetragenwerden.
Nackte Tatsachen: Lernenüber textileKultur
Ü
ber den Kontext von Pubertät und Adoleszenz hinaus
müssen die skizzierten Modephänomene auch im über-
greifenden Kontext einer medialen Nacktheitsvergesell-
schaftung betrachtet werden. Hier sollten unterrichtliche
Möglichkeiten genutzt werden, durch Medienanalysen
vestimentäre Rhetoriken der Nacktheit mit SchülerIn-
nen zu erkunden. Anknüpfungspunkte können mediale
Starinszenierungen sein oder auch Analysen von Mode-
journalen undWerbung.
I
n den kulturell heterogenen Feldern von Schule können
Modefragen auch Kulturvergleiche einbeziehen: Wie
wird Ver- und Enthüllen von SchülerInnen muslimischen
Glaubens interpretiert? Wo gibt es Differenzen? Wo gibt
es Überschneidungen? Wie kann man mit unterschied-
lichen vestimentären Praktiken umgehen? SchülerInnen
und auch Lehrende können in kulturellen Feldforschun-
genBekleidungsfragengemeinsamuntersuchenund sich
dabei gerade auch auf die Ambivalenz und Heterogeni-
tät des Feldes Schule beziehen. ImModus des gemein-
samen Feldforschens können vielschichtige vestimentäre
Lernprozesse stattfinden, in denen Jugendliche als kom-
petente Bekleidungs- undModeakteure gesehenwerden.
Bekleidungserlasse wären in einem solchen sozialen
Schul- und Lernfeldwahrscheinlich überflüssig.
Dr. Beate Schmuck
ist akademischeOberrätin
am Institut für Kunst undMaterielle Kultur
an der TechnischenUniversität Dortmund.
punktgenau
GEW sagt: Regeln ja –Normierungnein!
Während Schuluniformen in Großbritannien eine lange Tradi-
tion haben, steht Deutschland dem Einheitslook in Schule
eher kritisch gegenüber. Auch die GEW findet: Gute Schule
funktioniert anders.
Seit 2006 enthält das nordrhein-westfälische Schulgesetz in Para-
graf 42 diese Regelung: „Die Schulkonferenz kann eine einheit-
liche Schulkleidung empfehlen, sofern alle in der Schulkonferenz
vertretenen SchülerInnen zustimmen.“ Dass die SchülerInnen
in dieser Angelegenheit zustimmen müssen, mag überraschen.
Schließlich standdie Regelung im Schulgesetz vonCDUund FDP,
das Elemente der Schwarzen Pädagogik – etwa auch die Kopf-
noten – enthielt.Warumwar diedamalige Landesregierung inder
Klamottenfrage so zögerlich?
Das äußere Erscheinungsbild von SchülerInnen ist grundsätzlich
eine persönliche Angelegenheit, die durch die Grundrechte auf
freie Entfaltung der Persönlichkeit sowie das elterliche Erzie-
hungsrecht geschützt wird. Eine verbindliche Einführung ein-
heitlicher Schulkleidung kann vor diesem verfassungsrechtlichen
Hintergrund nicht durch die Schulordnung erfolgen. Schulkonfe-
renzen können hierzu nur empfehlende Beschlüsse fassen.
BefürworterInnen der Schuluniform betonen, sie trage dazu bei,
Ausgrenzung zu vermeiden und ein gutes Lern- und Sozialklima
zu entwickeln. Sie verweisen auf die Tradition von Schulunifor-
men, wie es sie in angelsächsischen Ländern gibt. Das Verständ-
nis der GEW von guter Schule ist jedoch ein anderes: Eine gute
Schule findet gemeinsam mit allen Beteiligten Regeln, die be-
rücksichtigen, dass Kleidung natürlich auch Kommunikation ist,
die Abgrenzung sein und Gruppenzugehörigkeit signalisieren
kann. Diese Regeln müssen aber der Individualität der Schüle-
rInnen Raum geben. Vergleiche mit anderen Ländern und Tradi-
tionen haben ihreGrenzen – die Inbrunst bei „Rule Britannia“ ist
auch nicht übertragbar.
FraukeRütter
ist Referentin der GEWNRW.