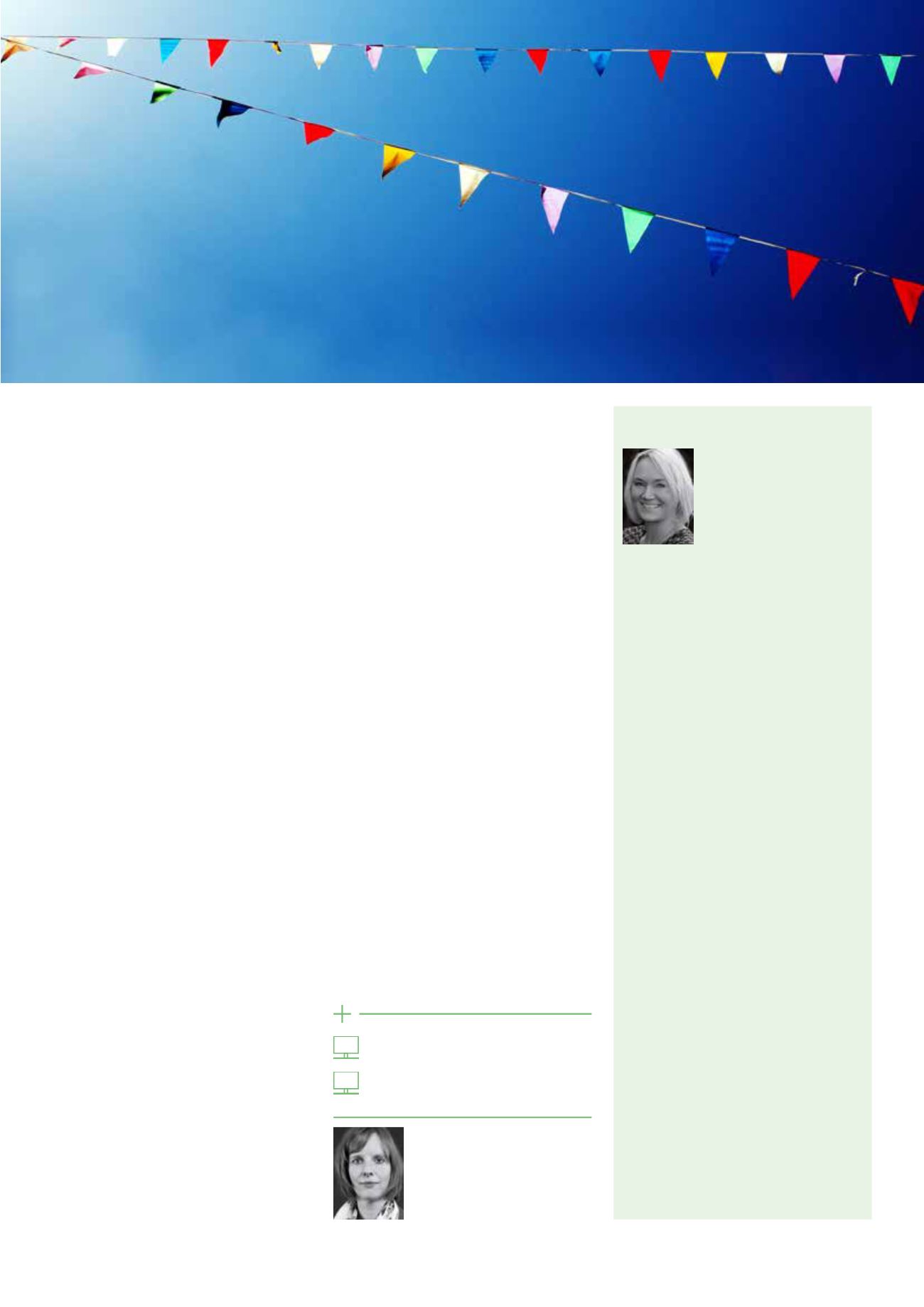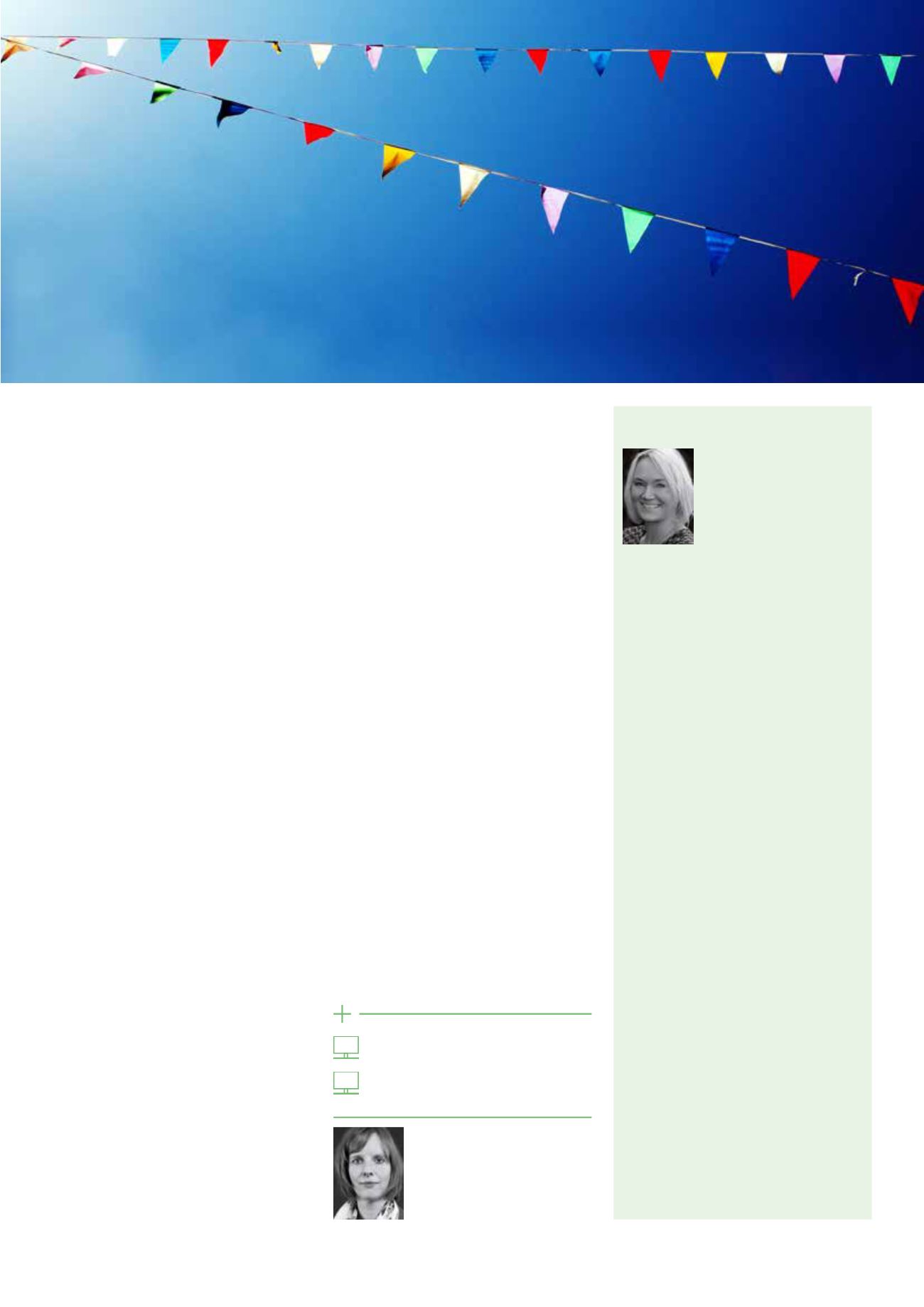
15
nds 10-2015
DGBBildungswerkNRW, GEWNRWunddieWestfälischeWilhelms-
Universität luden ein zur Summer School 2015unter dem Titel: Hetero-
genität als schulisches Potenzial –Kooperatives Lernen als Chance?!
Vom24. bis 25. September trafen sichbereits zum siebtenMal Vertrete-
rInnen aus Schule undHochschule inMünster und einigten sich
abschließend auf dieAntwort: Kooperatives Lernen ist eineChance!
Summer School 2015
Kooperatives
Lernen als Chance
ImFokusderVorträge, ForenundWorkshops
der diesjährigenSummer School standdie zen-
traleThese, dassHeterogenität ein schulisches
Potenzial darstellt und Kooperatives Lernen
für SchülerInnen eine gute Möglichkeit sozia-
ler Interaktion sowie kognitiven Austausches
bietet. Gerade vor demHintergrund inklusiven
Unterrichts sei das Lernen inKooperation eine
derbestenMöglichkeiten, umdieTeilhabealler
zu ermöglichen, erklärte der Pädagoge Prof.
Matthias vonSaldern in seinemEröffnungsvor-
trag.ModeratorinEvaHeidemannvomZentrum
für schulpraktische Lehrerausbildung in Essen
kündigte an, dass daher auch in Zukunft par-
tizipative Formatewie Soziometrie oderWorld
CafébeiderSummerSchool einewichtigeRolle
spielenwerden, umdieTeilnehmerInnenmitei-
nander in Kontakt zu bringen und Austausch
zu initiieren.
Kooperative Lernformengestalten
Prof.Dr. FranzWember vonder Technischen
UniversitätDortmundpräsentierte speziell für
dieTeilnehmerInnengruppezusammengestellte
Auswertungen der Hattie-Studie in Bezug auf
kooperative Lernformenund liefertewertvolle
Hinweise zur Interpretation der Ergebnisse.
Mithilfeweiterer empirischer Studien zeigteer,
dassdiesonderpädagogischausgebildetenLehr-
kräfte ingemeinsamverantwortetenUnterrichts-
einheitenhäufignur eineHelferInnenrolleein-
nehmenundmitDokumentationenbeschäftigt
sind. „Umdas zu vermeiden, ist eine gleichbe-
rechtigteGestaltungder Lernumgebungenvon
großer Bedeutung“, betonte er.
Schwerpunkte setzen imOpenSpace
Neuandieser Summer School war dieMög-
lichkeit für Lehrkräfte, FortbildnerInnen, Stu-
dierende sowie ReferendarInnen im Rahmen
eines Open Space selbst Impulse zu geben
und eigene Themenschwerpunkte und Ideen
zur Diskussion zu stellen. Neben kooperativer
Schulentwicklung ging es dabei auch um ak-
tuelle bildungspolitische Themen wie das Un-
terrichten in sogenannten Intensivklassen, in
denenFlüchtlingenunterschiedlicherHerkunft
Sprachkenntnisse vermitteltwerden. Auchhier
spieltKooperatives LerneneinewichtigeRolle,
dadurch verschiedene PerspektivenAuseinan-
dersetzungen auch im interkulturellenBereich
stattfinden.
Heterogenität alsPotenzial
Insbesondere die Foren undWorkshops bo-
ten Anlass zu vertiefenden Diskussionen über
Themen wie das Classroom-Management und
denUmgangmitMehrsprachigkeit imDeutschun-
terricht.AusdemBlickwinkelvonSchulleitungen
wurden Prozesse der LehrerInnenkooperation
thematisiert – speziell in multiprofessionellen
Teams.
DieTagungsleiterinnenEvaHeidemannund
Christine Preuß blicken auf eine gelungene
Veranstaltung zurück: „Mich hat besonders
beeindruckt, dass in vielen Gesprächen und
Workshops insbesondere die Haltung von
Lehrpersonen thematisiert wurde, die auf die
Verschiedenheit vonKindernund Jugendlichen
wertschätzend reagierenundHeterogenitätals
Potenzial für ihrenUnterrichtbegreifenundnicht
alsHürde“, sagt EvaHeidemann.
//
Nachgefragt
nds: Was macht Classroom-Management im Zu-
sammenhangmit Kooperativem Lernen aus?
Christiane Wanschers:
Classroom-Management
und Kooperatives Lernen sind eng miteinander
verbunden. So schafft ein effizientes Classroom-
Management zumeinendieVoraussetzungendafür,
dass beim Kooperativen Lernen – oder auch imUn-
terricht allgemein – die aktive Lernzeit erhöht wird.
Es dient außerdem demBeziehungsaufbau und der
Prävention vonUnterrichtsstörungen. Zum anderen
beinhalten die drei Säulen des Kooperativen Ler-
nensmeinerMeinungnach schon vieleAspekte des
Classroom-Managements. Im Grunde werden keine
Kompetenzen vorausgesetzt, sondern der Erwerb
von fachlichen, methodischen, persönlichen und
sozialenKompetenzenwird durch die aktiveGestal-
tung der Lernumwelt angestrebt.
Was sinddie zentralen Faktoren einer effizienten
Klassenführung? Wie unterstützt diese eine si-
chere Lernumgebung?
Die BildungsforscherInnen Jacob Kounin und
Carolyn M. Evertson bieten wichtige miteinander
verzahnte Anhaltspunkte, sodass ein Ranking
schwer zu erstellen ist. Eine wichtige Grundan-
nahme ist allerdings, dass, je genauer SchülerInnen
wissen, was sie wann und wie zu tun haben, desto
größer ist die Chance, dass sie sich daran halten.
Das bedeutet, dass wir Lehrkräfte Regeln und Ver-
fahrensweisen genau formulieren, erklären und
gegebenenfalls mit den SchülerInnen einüben
müssen. Um eine sichere Lernatmosphäre herstel-
len zu können und die LehrerInnen-SchülerInnen-
Beziehungpositiver zu gestalten, ist es sinnvoll
genau hinzuschauen, welche sozialen Fähigkeiten
SchülerInnen bereits mitbringen. Fehlende soziale
Fähigkeiten sollten dann aufgebaut werden statt
eine böse Absicht zu unterstellen und zu sank-
tionieren. Und bevor lange Regelkataloge den
Klassenraum schmücken, empfehle ich, ein Sozial-
ziele-Center einzuführen und konkrete Indikatoren
für erwünschte Verhaltensweisen zu benennen.
ChristianeWanschers
Grundschulleiterin inOchtrup
sowieModeratorin in der
staatlichen Lehrerfortbildung
und zertifizierteGreen-Trainerin
für das Kooperative Lernen
Christine Preuß
Tagungsleiterin der Summer School
2015 sowie Leiterin des Zentrums
für Lehrerbildung an der Universität
Darmstadt
Summer School 2010–2015
NDS-Verlag: BuchreiheKooperatives Lernen
Foto: zettberlin/photocase.de