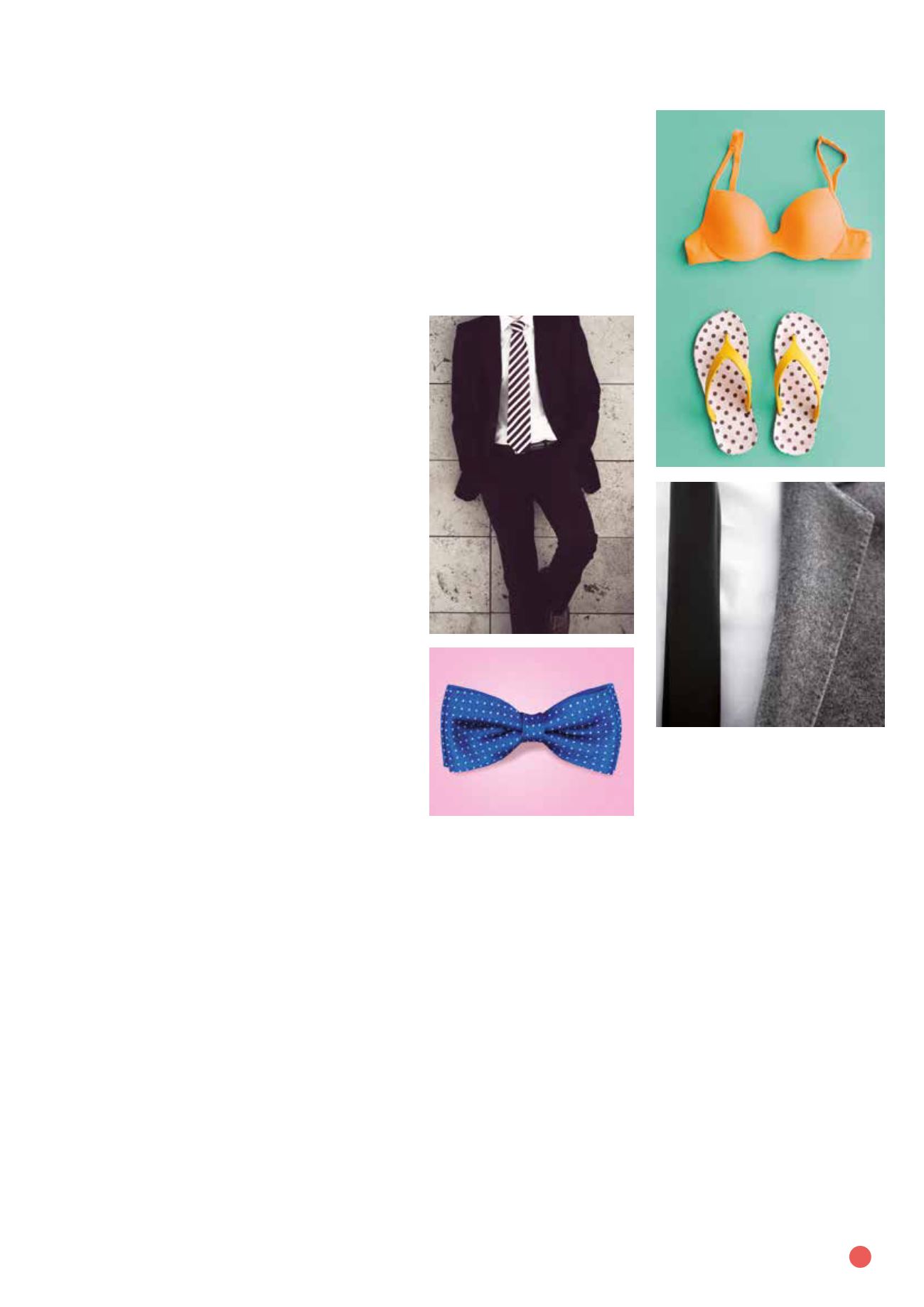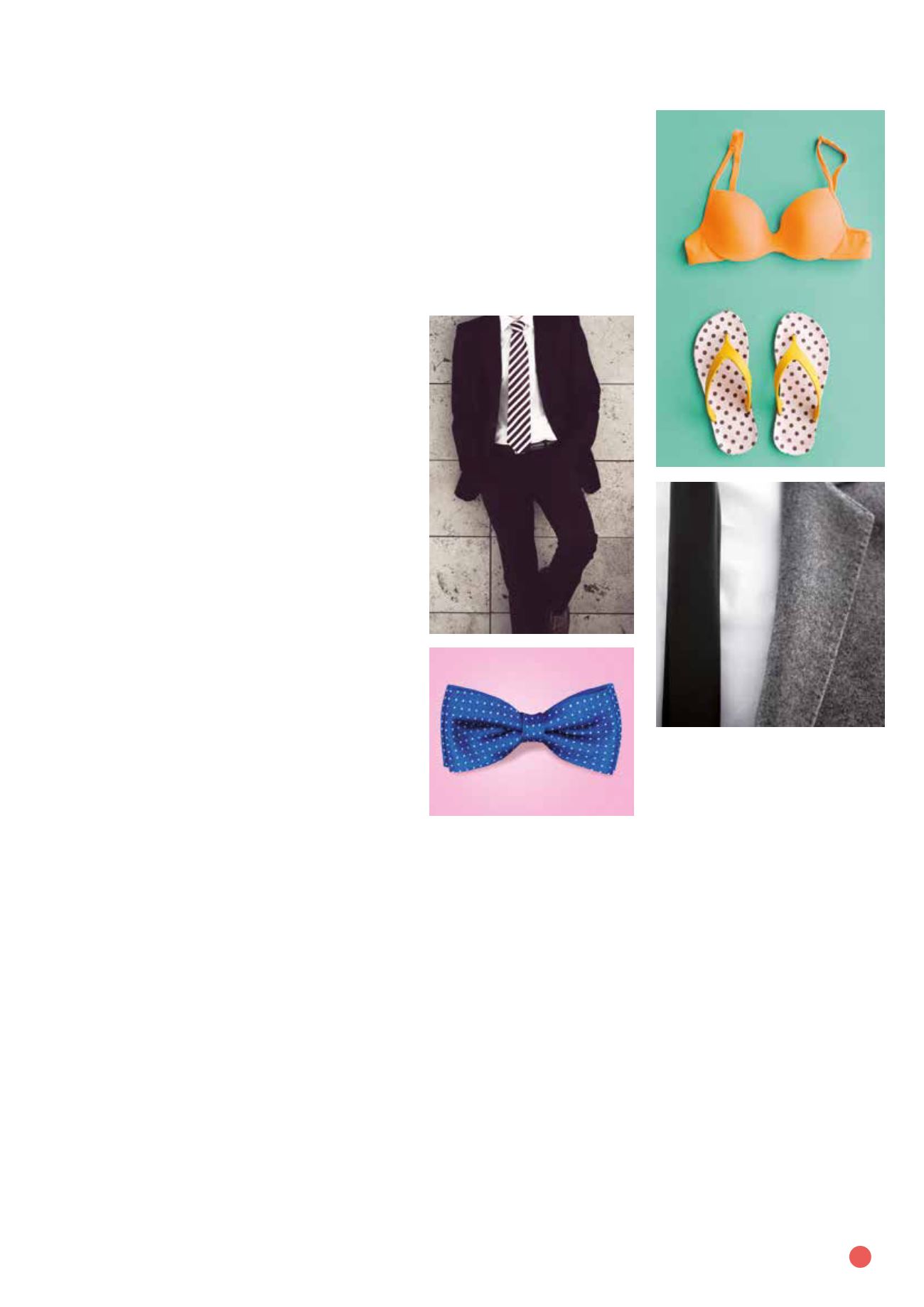
3
K
leider haben ihre eigene Sprache. Sie „transportieren
Ordnungsmuster, die es uns in Sekundenschnelle erlau-
ben den gegenüberliegendenMenschen gesellschaftlich
einzustufen“, so Iris Kolhoff-Kahl, Professorin für Textil-
gestaltung. Diese „konformen Muster des kollektiven
Wissens“ sind durchaus hilfreich, um sich in Alltags-
situationen schnell zurechtzufinden. Hinter einemHerrn
im Anzug vermuten wir direkt Seriosität, vielleicht einen
Bankangestellten,würdenaber kaumaneinenHausmeis-
ter denken. Bei Frauenmit Kopftuch, jungenMädchen in
Hotpants oder bei TrägerInnen von Spruch-T-Shirts flam-
men entsprechend andere (vorurteilende) Bilder in unse-
renKöpfenauf. DieseVorurteile sind jedochnicht vorher-
bestimmt, sondernbedingt durchunsere kulturelleBrille.
D
as Umfeld und die Kultur, in der wir aufwachsen, beein-
flussendieArt,wiewirDingewahrnehmenundwiewirbe-
stimmte (Kleidungs-)Symboleeinordnen. Inverschiedenen
Kulturkreisen verbinden Menschen völlig andere Dinge
mit genau denselben Kleidungsstücken und -symbolen:
„Schwarz bedeutet nicht notwendigerweise Trauer, ein
Rock bedeutet nicht in allen Kulturen weiblich“, weiß
Designforscher Professor Carlo Sommer. Kleidung ist
somit das Ergebnis einer soziokulturellen Übereinkunft
und ein „Medium nonverbaler Kommunikation“.
K
leidungbietet dieMöglichkeit, eigene Identitätsvorstel-
lungen für andere sichtbar zumachen. Dabei ist die Ba-
lance zwischen Anpassung und Abgrenzung besonders
wichtig. Weicht Kleidung zu sehr vonder kulturell verein-
bartenNormalvorstellung in einer bestimmten Situation
ab, so müssen die TrägerInnen mit Sanktionen rechnen.
Man kann sich gut vorstellen, was passiert, wenn eine
Frau imBikini auf eineHochzeit geht. Ähnlich verhält es
sich, wenn sichSchülerInnenentgegenderNorm kleiden.
Sie fallenauf und störendasNormalbild. Gerade Jugend-
liche nutzenKleidung jedoch, ummit ihrer eigenen Iden-
tität zu experimentieren. Diese zweite Haut bietet ihnen
die Möglichkeit, verschiedene Rollen einzunehmen und
sich selbst darin zu erproben. Für die Entwicklung der ei-
genenPersönlichkeit ist das sehrwichtig, kann jedochbei
(vermeintlichen) Verstößen gegen kulturell vorherrschen-
de Kleidungsnormen zu Unverständnis und Konflikten
führen.
A
uch LehrerInnen in scheinbar unpassender Kleidung
sorgen für Unruhe. Berufskleidung in anderenBereichen,
wie zum Beispiel bei Bankangestellten, ist häufig ver-
einheitlicht. Insbesondere Uniformen symbolisieren den
Berufsstandunddienenhäufigauchdem Schutz der Per-
son, deren Individualität hinter der Kleidung zurücktritt.
ImVordergrund steht die durchdieKleidung verdeutlich-
teFunktionder Person. Gleichzeitig verändernUniformen
Hotpants, Schlabberhosen, Tanktops und Co in der Schule? Laut vielen
SchulordnungenabsoluteNo-Gos. Dochwoher kommt dieHaltunggegen-
über bestimmtenKleidungsstücken?
DieSprachederKleidung
nicht nur den äußeren Habitus von Menschen, sondern
bestimmen auch ihre Verhaltensweise, schrieb Ingeborg
Petrascheck-Heim bereits 1966 in „Die Sprache der Klei-
dung: Wesen undWandel der Tracht, Mode, Kostüm und
Uniform“.
W
ir verhalten uns also entsprechend der Kleidung, die
wir tragen. Für LehrerInnen gibt es inDeutschland keine
vorgeschriebene Berufskleidung. Geht man vom Rollen-
verständnis einer modernen Lehrkraft als LernbegleiterIn
oder Lerncoach aus, die SchülerInnen unterstützt, ohne
dabei allzu sehr im Mittelpunkt zu stehen, gleichzeitig
aber auch eine Vorbildfunktion erfüllt, so können sich
LehrerInnen selbst die eine oder andere Regel für ange-
messene Kleidung ableiten.
Eva-ChristinKoch
ist Lehrkraft für besondereAufgaben an der
Fakultät für Kulturwissenschaften
der Universität Paderborn für das Fach Textilgestaltung.
Fotos (von oben nach unten):
aimy27feb/shutterstock.com;
flobox, himberry /photocase.de;
Lucy Liu/shutterstock.com
punktlandung2015.2