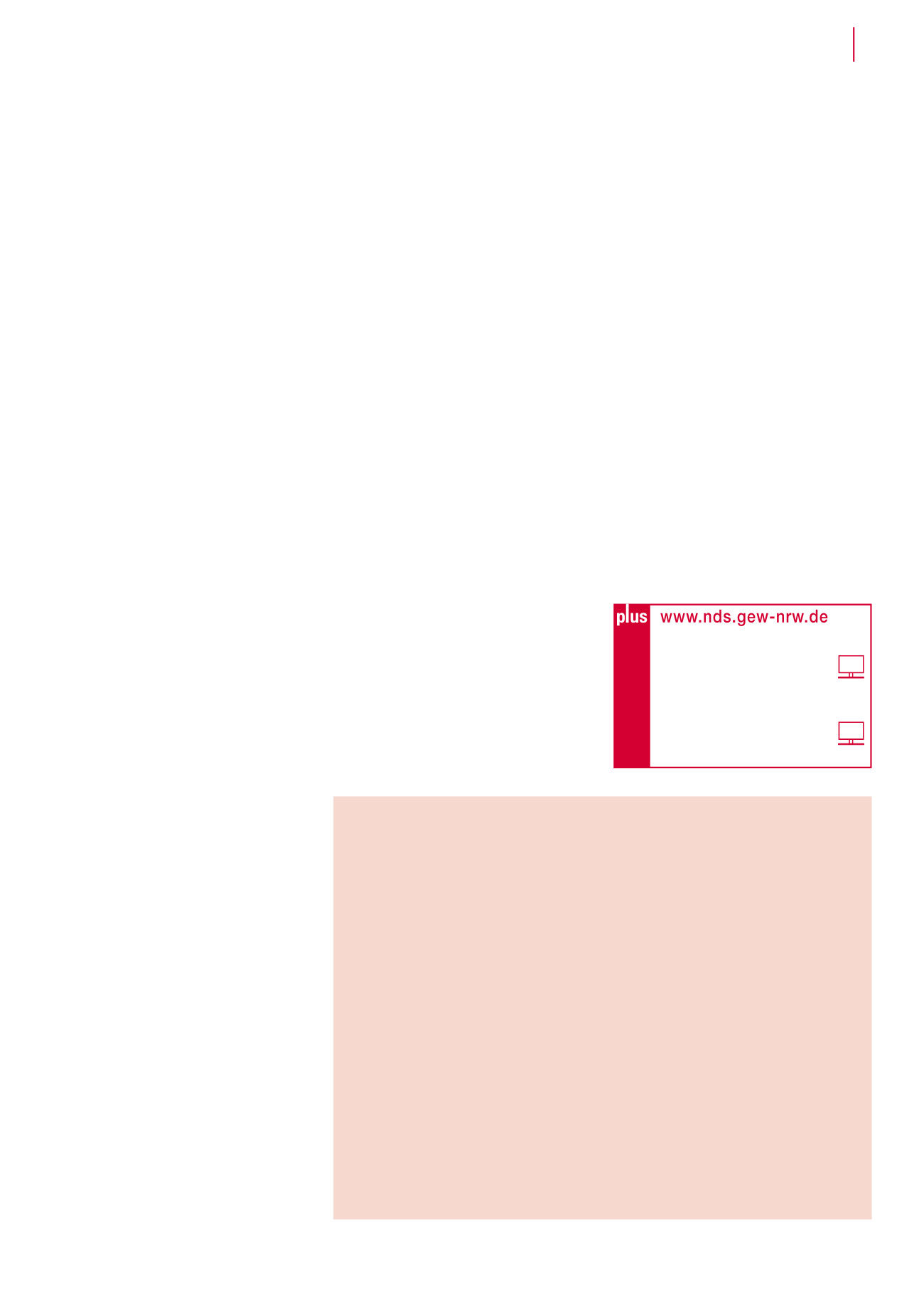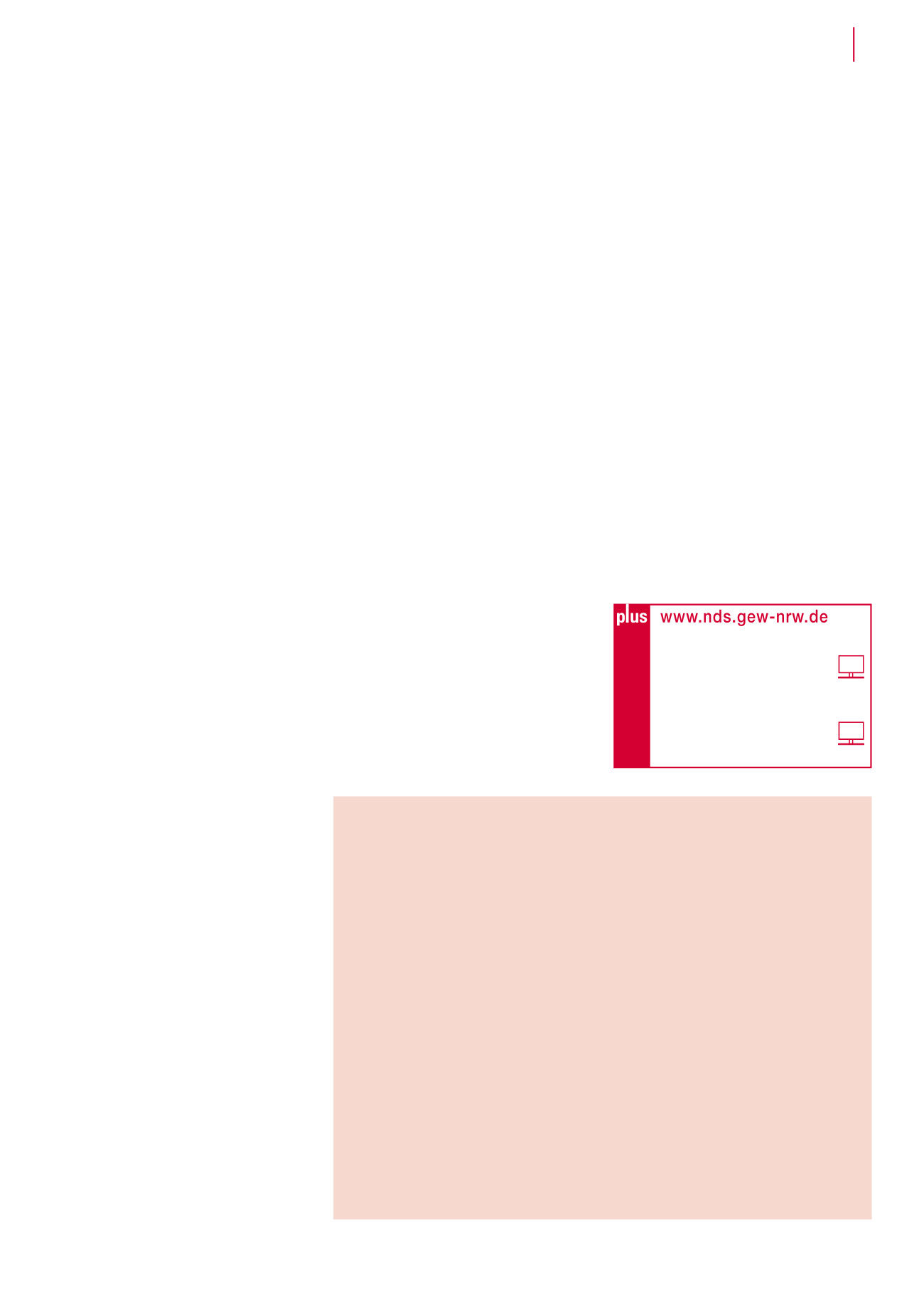
Kommentar
Frauensache?
„Lehrerwird zum Frauenberuf –Verbände sind ent-
setzt“, titelte die WAZ im Oktober 2014. Entsetzt
zeigt sich imBeitrag in erster Linie der Philologen-
verband, für den der Trend einer „Katastrophe“
gleichkommt. „Die Feminisierung des LehrerInnen-
berufes beeinträchtigt die Erziehung“, konstatiert
der Vorsitzende Peter Silbernagel.
Der Artikel zementiert letztlich genau die Annahme,
die er unbedingt vermeiden möchte: Dass Eigen-
schaften geschlechtsgebunden sind. Dass Männer*
Kindern bestimmte Dinge besser vermitteln können
als Frauen*. Aber das ist falsch: Unsere Eigenschaf-
tenhängennicht vonunseremGeschlecht ab – schon
gar nicht von unserem biologischen. Die Sternchen
kennzeichnen das heteronormative Geschlechterbild
hinter den Begriffen und sollen Menschen sichtbar
machen, die sich darin nicht wiederfinden. Die unre-
flektierte Reproduktion dieses Geschlechterbildes ist
ebenfalls zu kritisieren.
Der pauschale Verzweiflungsruf nach „Vaterfiguren“
in den Schulen ist jedenfalls verkürzt: Was wir in
Schulen brauchen, sind Vorbilder, die ein möglichst
breites Spektrum unserer heterogenen Gesellschaft
abbilden, um Kindern vielfältige Identifikationsmög-
lichkeiten zu bieten. Außer Männern* fehlt es den
Schulen nämlich noch an weitaus mehr Personen-
gruppen, die man ebenso beliebig herausgreifen
kann: trans- und intersexuelle Lehrkräfte, Lehrkräfte
mit Migrationshintergrund, behinderte Lehrkräfte, ...
Diese Liste führt ins Unendliche. Und deshalb lautet
mein persönlicher Appell nicht: „Wir brauchenmehr
Männer*!“ Er lautet vielmehr: „Wann begreifen wir
endlich, dass Kindererziehung und Bildung
gemein-
schaftliche
Aufgaben höchster Priorität sind?!“ Leh-
rerInnen müssen besser ausgestattet, besser bezahlt
und besser ausgebildet werden, damit dieser Beruf
seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht
werden kann! Das ist das Problem unseres Bildungs-
systems – nicht, dass es mehr Lehrende mit weib-
lichenGeschlechtsteilen gibt.
P.S.: Ein ähnliches und ebenso großes Problem sind
die prekärenBerufsmöglichkeiten (alleinerziehender)
Frauen*.
EvaCaspers, jungeGEWNRW
27
nds 8-2015
bestmöglich und individuell zu fördern. In
diesem Kontext ist es relevant, dass eigene
geschlechtsspezifische Vorannahmen erkannt
und abgelegt werden, sodass die Perspektive
auf die SchülerInnen unverstellter und damit
realistischer wird. Genderkompetenz bedeutet
auch, zu verinnerlichen, dass das Geschlecht
einer PersonkeinegeeigneteKategorie ist, um
IndividuenbestimmteKompetenzen vonVorn-
hereinzu- oderabzusprechen:weder imHinblick
auf die Prognose von Verhalten, noch für die
vonLeistung, FörderungoderUnterrichtsgestal-
tung. Genderkompetente Lehrkräfte initiieren
idealerweise förderlicheLehr-Lern-Interaktionen,
die dazu führen, dass Kinder und Jugendliche
sich als Person, unabhängig von sozialen oder
biologischen Eigenschaften, wahrgenommen,
wertgeschätzt und unterstützt fühlen.
Relevant für die schulische Praxis ist auch:
SowohlMädchenalsauchJungenwerdendurch
gesellschaftlicheZuweisungenvoneinengenden
Geschlechterstereotypen in ihrer Entwicklung
behindert. DieVeränderung vonGeschlechter-
gerechtigkeit ineinerGesellschaftentstehtdurch
die Veränderung von geschlechterstereotypen
Vorstellungen–undwosolltengrößereChancen
fürdie InitiierungdieserVeränderungbestehen
als in der Schule?!
Von Frauen dominierte Berufe und Berufs-
felder leidenmeist unter geringemAnsehen
und schlechter Bezahlung. Trifft das auf den
Schulbereich auch zu?
Die Statistiken zeigen, dass imGrundschul-
bereichdiemeistenFrauen tätig sind. Schauen
wir zudenweiterführenden Schulen, sofinden
wir hier einen vergleichsweise höheren Anteil
an Männern. Frauen, obwohl am Gymnasium
nominell beispielsweise in der Überzahl, be-
setzen dort jedoch zu einem deutlich höheren
Prozentsatz die Teilzeitstellen.
WennverantwortlicheStellensichmehrmänn-
liche Lehrkräfte an den Schulen wünschen,
ist die Aufwertung des Berufs das Mittel der
Wahl.Der Lehrberuf istheutzutageunglaublich
komplex, LehrerInnen sind stetig wachsenden
Anforderungen ineinerVielzahl vonBereichen
ausgesetzt. Gleichzeitig erhöht sich der Druck
der Gesellschaft, der Eltern, der Politik: Das
Bildder LehrerInnen ist inDeutschlandhäufig
negativ besetzt. Außerdem gilt hier: Zwar sind
viele Lehrkräfte inder komfortablen Situation,
eineBeamtenstelle zubekleiden.Anerkennung
von herausragenden Leistungen und ganz all-
gemeinGratifikationenexistieren jedochkaum,
auchdieAufstiegsmöglichkeiten sind limitiert.
EinweitererAspektkommthinzu: FürFrauen
bietet sichdieSicherheitdesLehrerInnenberufs
aus traditionellerSicht zwecksVereinbarkeitmit
derFamiliean.Männer trauensichhäufigmehr
Unsicherheit einerseits, aber damit verbunden
auchmehr Aufstiegschancen andererseits zu.
Attraktive Beförderungsstellen im Schul-
bereich sind vorwiegend männlich besetzt.
Wasmuss sichändern, umdieses Schema zu
überwinden?
Die Lösung ist eher auf einer gesamtge-
sellschaftlichen Ebene zu suchen. So wissen
wir aus der Forschung, dass sich die Zeit der
Familiengründunghäufigkritischaufdieweitere
Karriere von Frauen auswirkt, die sogenannte
„Retraditionalisierungsfalle“ schnappt zu. Und
daszueinerZeit inderberuflichenLaufbahnvon
ArbeitnehmerInnen, inderhäufigentscheidende
Wege für attraktive Beförderungsstellen geeb-
netwerden. Für eineVeränderungwird sowohl
ein Umdenken in den Köpfen der Individuen
als auch der Institutionen benötigt: Warum
setzen deutlichmehr Frauen nach der Geburt
der Kinder für eine lange Zeit aus alsMänner?
Weshalb istdieTeilzeitarbeitsratevonMännern
und Frauen so ungleich?
In diesem Bereich gilt auch: Die Kombina-
tionsmöglichkeiten bei der Kinderbetreuung
sind in der Regel vielfältiger als die Lösung,
dassFrauen langeZeitberuflichaussetzenund
dann in Teilzeit in den Beruf zurückkehren.
Doch vielfach blockiert die sozial beeinflusste
Orientierung an tradierten Vorgehensweisen
von Mehrheiten das bloße Nachdenken über
andere, möglicherweise für beide Partner viel
befriedigendereWege.
Des Weiteren gilt: Selbst in einem eher
familienfreundlichen Arbeitsbereich wie der
Schule zeigt sich bei der Vergabe von Beför-
derungsstellen, dass kleine Kinder – implizit
oder explizit – nach wie vor als mindernd für
die Leistungsfähigkeit von Frauen angesehen
werden.Auchhierkannetwasverändertwerden:
Die Schaffung früher und flexibler Wiederein-
stiegsmöglichkeiten,geteilteFührungsaufgaben
und ein gesellschaftlich veränderter Blick auf
die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Fa-
miliedurchMännerundFrauengleichermaßen
könntendafür sorgen,dasssich langfristigauch
mehrFrauenaufattraktivenBeförderungsstellen
befinden. Im Kern geht es letztendlich jedoch
auchdarum:DieKindererziehungmüsstedeut-
lichalseinegesellschaftlicheLeistunganerkannt
werden, in welche sich Männer genauso wie
Frauen einbringen.
Die Fragen für die nds stellten
Anke Böhm und Ilse Führer-Lehner.
KristinBehnke: Feminisierung im
Schulbereich (Zusammenfassung
des Vortrags bei der GEW-Landes-
frauenkonferenz 2015)
Matthias Korfmann: Lehrer wird
zum Frauenberuf – Verbände sind
entsetzt (WAZ/derwesten.de vom
31.10.2014)