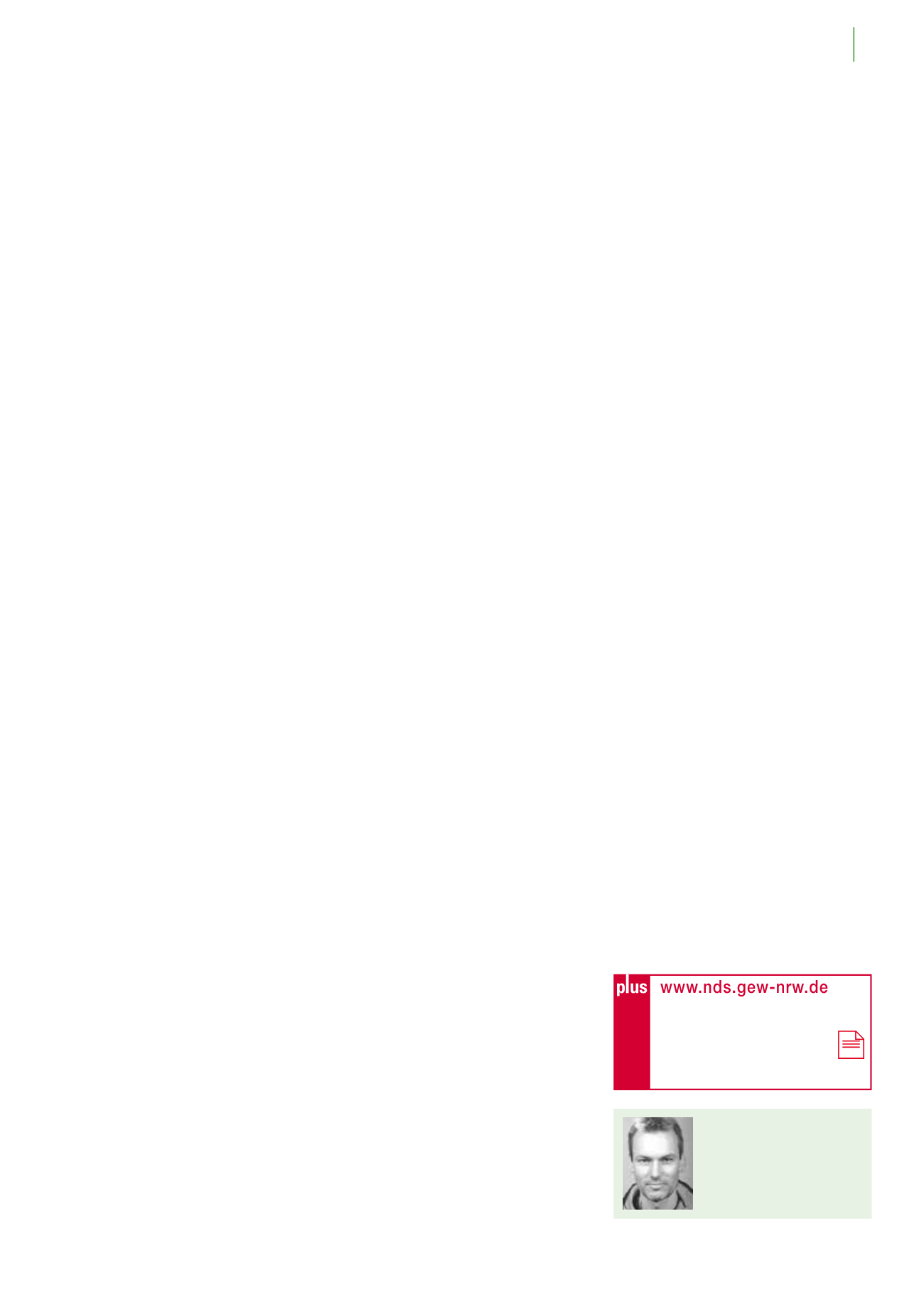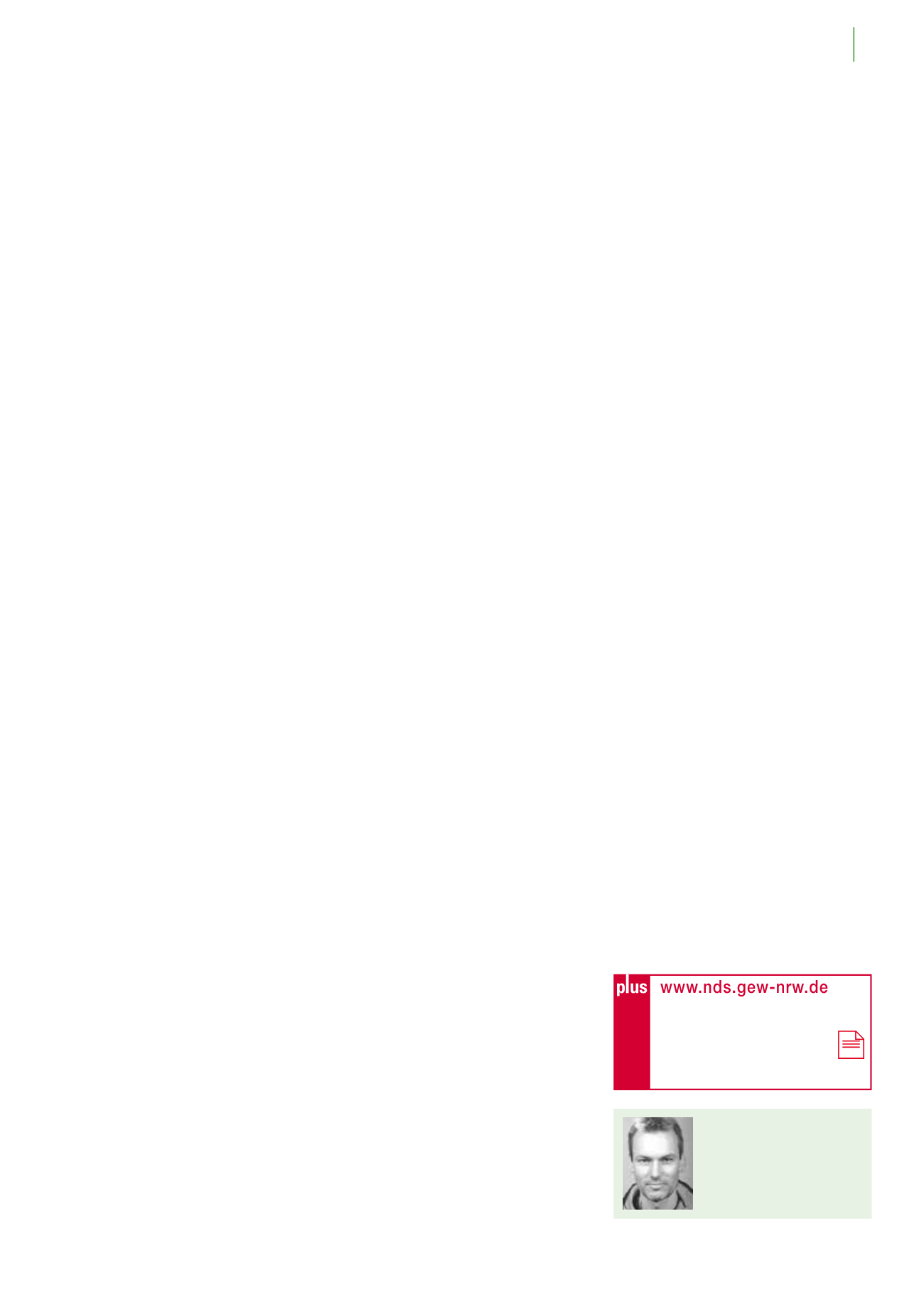
11
nds 5-2015
SiljaGraupe, JochenKautz: Die
Macht derMessung.WiedieOEC
mit PISA einneues Bildungskon-
zept durchsetzt
(COINCIDENTIA, Beiheft 4, 2014)
Hartmut vonHentig rechnet die „Wahrneh-
mung von Glück“ zu den wesentlichen Merk-
malen gebildeter Menschen. Beim Blick auf
die vorläufigen Trends unserer SV-Befragung
kommen Zweifel auf, ob wir mit Schule ein
solches Ziel tatsächlich noch im Blick ha-
ben. Verstehen wir Bildung wie Wilhelm von
Humboldt als „Anregung aller Kräfte des
Menschen,damitdiesesichüberdieAneignung
der Welt entfalten und zu einer sich selbst
bestimmenden Individualität und Persönlich-
keit führen“? Finden sich Bildungsziele wie
Demokratiefähigkeit, Toleranz, Kritikfähigkeit,
sozialeKompetenz, Kreativität, die nach1945
in einem weiten Bildungsverständnis selbst-
verständlich mitgedacht wurden, immer noch
in aktuellen Schulentwicklungstrends? Oder
verfolgenwir längst einen ganz anderen Lehr-
plan, der unreflektiert nur noch Punkten und
Rankingshinterhereilt?Wie siehtesausmitder
„Selbstverwirklichung insozialerVerantwortung“
als oberstemBildungsziel?
Seit Veröffentlichungder erstenPISA-Studie
im Jahr 2000 ist der Blick der Schulpolitik zu-
nehmendfixiertaufmessbareundstatistischver-
wertbareDaten,diedannnormativals„Bildung“
definiertwerden. Tatsächlichwirdaber nur ein
sehrengerBereichmenschlicherBildungerfasst.
AbgeleitetwerdendarausPISA-folgerichtig im-
mermehr Setzungen indenBereichenSprache,
NaturwissenschaftenundMathe.Daswachsende
BildungspflichtprogrammschränktdieWahlmög-
lichkeitenderSchülerInnenzunehmendein.Die
steigendeZahl zentralerPrüfungenverstärktden
fremdbestimmtenDruck zusätzlich.
Kannman in einem standardisierten
System individualisieren?
Soweit schlimmgenug,meineBauchschmer-
zen – jetzt grummeln noch die Widersprüch-
lichkeiten hinzu. Wie vereinbaren wir die
Standardisierungen durch zentrale Prüfungen
mit der geforderten individuellen Kompetenz-
orientierung? Wie lösen wir den Widerspruch
der Inklusion innerhalb eines selektierenden
Berechtigungsschulwesens auf?
VieleKollegienberichtenübereinesteigende
Zahl vonSchülerInnenmit immer schwierigeren
Lebensgeschichten. Glaubenwir allen Ernstes,
dass ihnennochmehr Inhalte, nochmehr Prü-
fungen und nochmehr Druck helfen können?
Kann es sein, dass wir Bildungsbereiche wie
Demokratiefähigkeit, Toleranz, Kreativität und
Empathiestückweiseausblenden?Warumergrei-
fenwir nichtmit der gleichenEntschiedenheit,
mit der wir immer neue Standards definieren,
Maßnahmen, die in diesen Bereichen so not-
wendigwären?
Derweil setzen sich im Unterricht heim-
liche Lehrpläne fort. Erwartungshorizonte und
Punktesysteme suggerieren Objektivität. Statt
zu fragen „Was kann ichaus Xoder Y fürmein
Lebenerfahren?“, sinddieLernenden fokussiert
auf die Frage: „Wie funktioniert das Prüfungs-
format und wofür bekomme ich die meisten
Punkte?“ Bei LehrerInnen sieht es nicht anders
aus: Seit der Einführung zentraler Prüfungen
hängen an ihren Pinnwänden die geforderten
Schwerpunkte für das Zentralabitur oder die
ZentralenAbschlussprüfungen. Zeit füraktuelle
oder lebensrelevanteThemenausder Sichtder
SchülerInnengibteskaumnoch. Ebensowenig
ZeitundMittel fürBeziehungsarbeit,diegerade
SchülerInnenmitschwierigenLebensgeschichten
dringend brauchen.
MussBildungdenGesetzen
derÖkonomie folgen?
UndamEndevergleichenwirunsdann regel-
mäßigmit „PISA-Siegerstaaten“wie Japanoder
Singapur. Nur zur Erinnerung: In japanischen
KindergärtendürfendieKinderperGesetzbald
nichtmehrdraußen spielen,weil derGeräusch-
pegel zuhoch fürWohngebiete ist. Singapur ist
derStaat, indemkürzlichzwei Jugendlichenach
Graffiti-SprühereienzuneunMonatenGefängnis
und drei schwer verletzenden Stockschlägen
verurteiltwurden.Mitwemvergleichenwiruns
eigentlich?Undwollenwir tatsächlich indiese
Richtung steuern?
DieOECDalsSchöpferinderPISA-Testsmacht
keinenHehl daraus, dass schulischeErziehung
vorallemunterdemGesichtspunktderÖkonomie
betrachtetwerdenmüsse. „InderSchulesoll jener
Grundsatz von Einstellungen, von Wünschen
undErwartungengeschaffenwerden, der eine
Nation dazu bringt, sich um den Fortschritt
zu bemühen, wirtschaftlich zu denken und zu
handeln“, hieß es schon 1961 im Bericht zur
OECD-Konferenz.EinesolcheFixierungderPISA-
StudienzerstörediezwischenmenschlicheBasis
despädagogischenGeschehens,haltendieÖko-
nomin SiljaGraupe und der Didaktikprofessor
Jochen Krautz 2014 in der bildungskritischen
Zeitschrift COINCIDENTIA dagegen.
Bietenwirmit Schule Lösungen
oder sindwir Teil desProblems?
Doch diese Erkenntnis scheint bei den
bildungspolitischenEntscheidungsträgernnoch
nicht angekommen zu sein. ReformenundAn-
passungen folgen stattdessenkonsequentdem
vorgegebenenDenkmuster.Dieangeschwollene
Stundentafel der Oberstufen lässt kaum Frei-
räume für ein Erproben des Erlernten in der
realen Welt. Nach Schulschluss, oft erst weit
nach 16.00 Uhr, folgen Hausaufgaben und
Klausurvorbereitungen. UmUnterricht in den
frühenAbendstunden zuvermeiden, verzichten
viele Schulen aufMittagspausen.
Sportvereine klagen gleichzeitig über
Mitgliederschwund; Kirchen und Verbänden
gehen die ehrenamtlichen Kräfte aus. Psycho-
logische oder psychiatrische Beratungsstellen
habenWartezeiten vonbis zu einem Jahr, weil
sie die Flut der Kinder und Jugendlichennicht
bewältigenkönnen.Habenwir inSchulenStruk-
turen, die vor solchen Tendenzen bewahren?
Oder sindwirmit Schulemittlerweilemehr Teil
des Problems denn der Lösung?
CarstenPiechnik
Carsten Piechnik
SV-Lehrer an der Erich-Fried-
GesamtschuleHerne
Einfach genial, genial einfach, oder? Da spüren die Jugendlichen etwas für sie
Bedeutsames und fragen einfachnach ... Ich komme insGrübeln. Undbekomme
Bauchschmerz. InwelcheRichtung steuert unser Bildungssystem?
Gedanken aus der Sicht eines begleitenden Lehrers
Mit Vollgas in die falsche Richtung