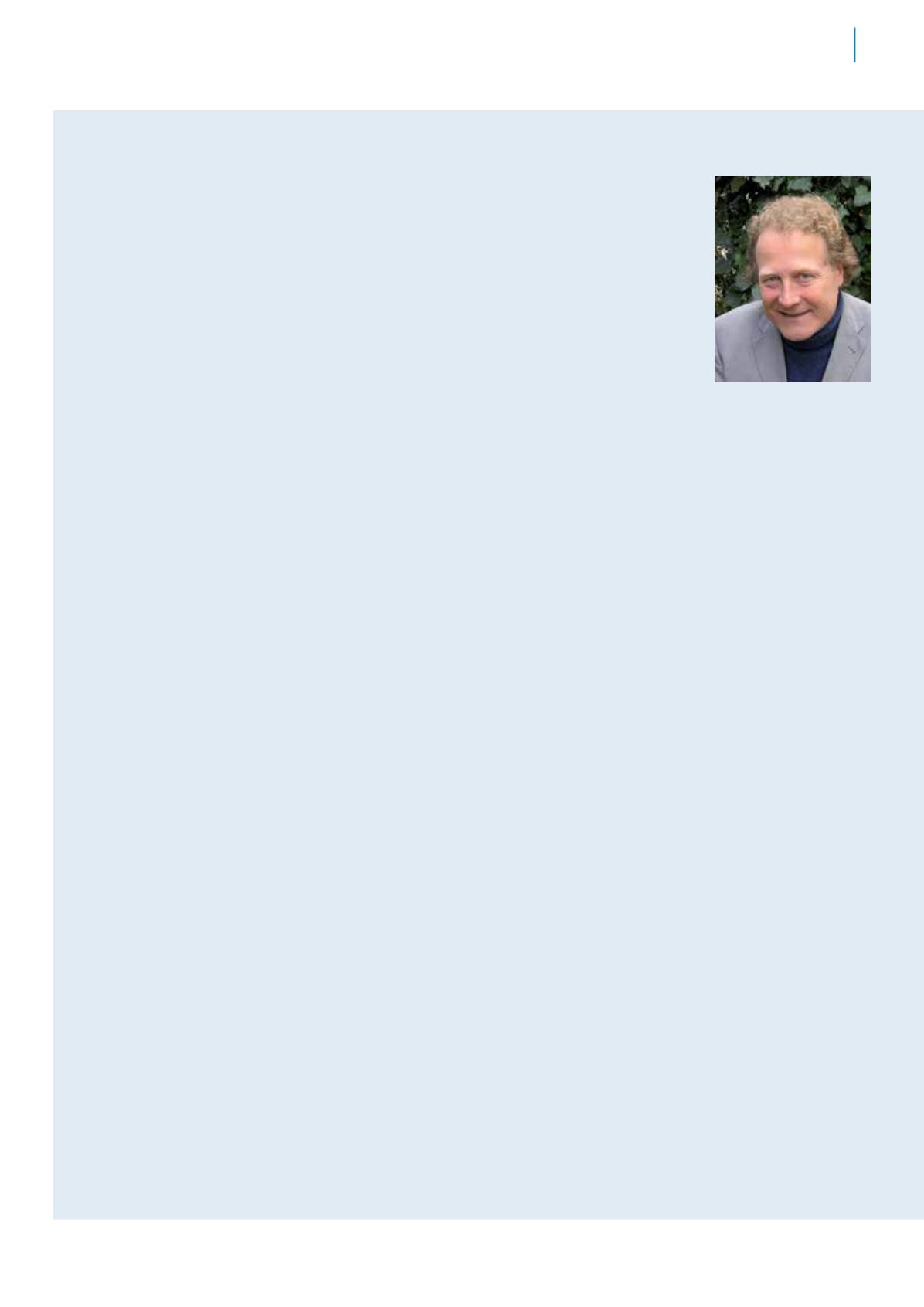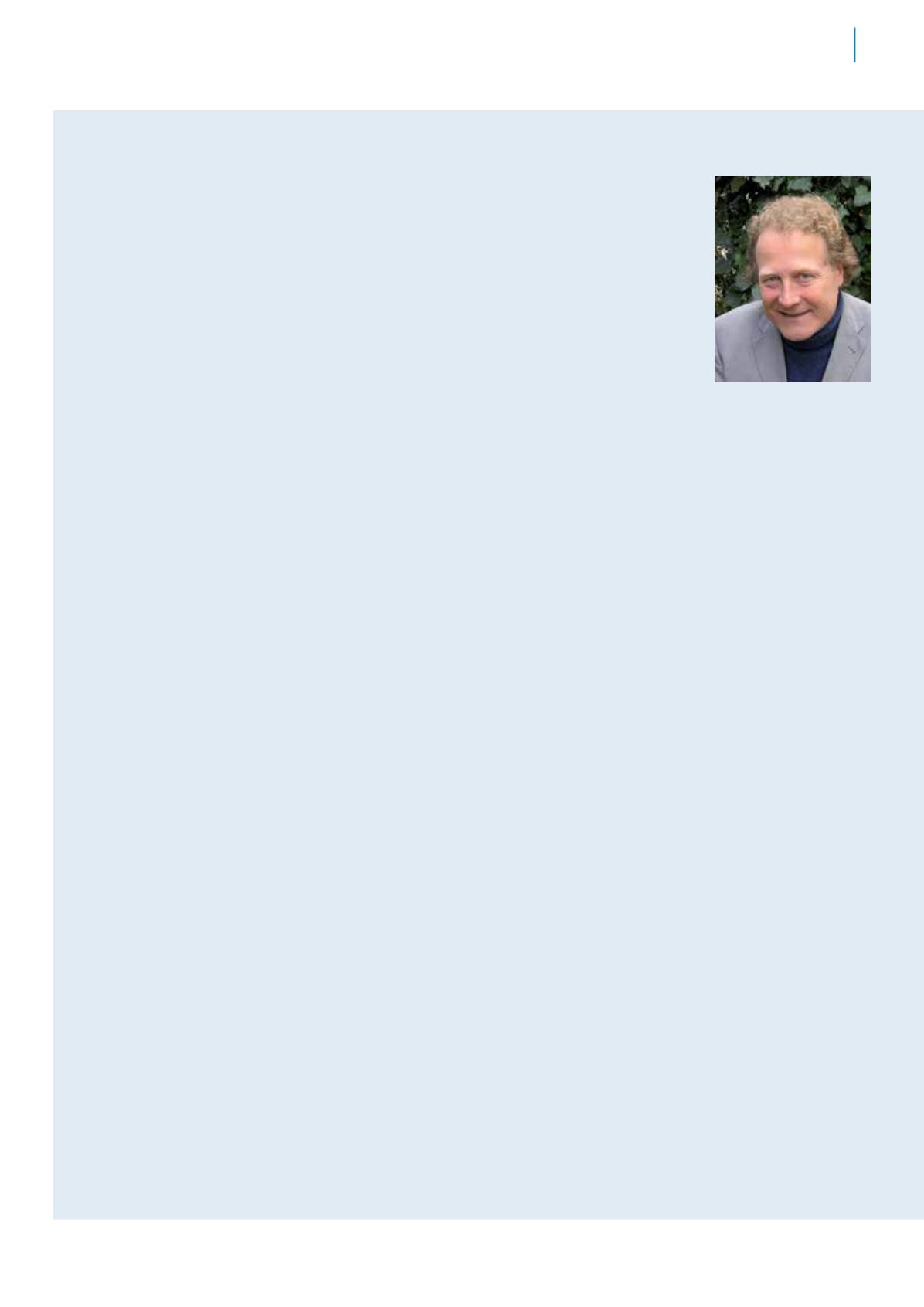
3
nds 5-2013
Gesunde Verhältnisse
Die Arbeit kann für den Menschen eine Quelle der Befriedigung sein. Doch kann sie uns
auch krank werden lassen. Nur in wenigen Berufen lässt sich der Wunsch, bei der Erfüllung
der beruflichen Aufgaben gesund zu bleiben, derart schwierig einlösen wie in den Bildungs
und Erziehungsberufen – vor allem unter den derzeit gegebenen Bedingungen. Entwertungen
der von Beschäftigten in Schulen geleisteten Arbeit, wie wir sie dieser Tage wiederholt –
diesmal von höherer philosophischer Warte durch Richard David Precht – erleben, sind ein
Ärgernis. Anstatt Teil der Lösung zu sein, sind negative Pauschalurteile über unsere Bildungs
einrichtungen eher ein Teil des Problems.
Von verschiedener Seite wird SchülerInnen und deren Eltern immer wieder vorgegaukelt, alles
in der Schule müsse alle permanent begeistern. Wenn das nicht der Fall sei, dann seien die Leh
rerInnen und falsche Lehrmethoden schuld. Anstatt Eltern zur vertrauensvollen Zusammenarbeit
mit der Schule aufzufordern und ihren Kindern ein Minimum an Anstrengungsbereitschaft
abzufordern, erzeugt man jene Unzufriedenheit, die man dann als Beweis dafür ausgibt, unsere
Schulen und ihre LehrerInnen seien schlecht.
In allen Berufen sind die beiden klassischen Ansatzpunkte für die Erhaltung der beruf
lichen Gesundheit „Verhältnisse“ und „Verhalten“: Mit „Verhältnissen“ sind die Bedingungen
am Arbeitsplatz gemeint. Zustand und Ausstattung unserer Schulen rufen nach einem milli
ardenschweren Investitionsprogramm. Dies vor allem mit Blick auf die dringend erforderliche
Umgestaltung unserer Schulen in Ganztagsbildungsstätten und die in diesem Zusammen
hang anstehende Einrichtung von Lehrerarbeitsplätzen. Wenn ich mich an die Steuermilli
arden erinnere, die vor Jahren für die „Abwrackprämie“ anstatt für die Bildung ausgegeben
wurden, steigt bei mir heute noch der Blutdruck.
Welche Rolle das „Verhalten“ für den Erhalt der Gesundheit spielt, muss man Beschäftigten
im Bildungs- und Erziehungsbereich nicht erklären – soweit es die Ernährung, den Sport und
die Abstinenz von Suchtmitteln betrifft. Sorgen macht Medizinern neuerdings jedoch das neu
robiologisch schädliche Multitasking. Denn für das Gehirn ist gut, möglichst immer nur eine
Sache zu einer Zeit zu machen. Und auch der Ruin der Nachtruhe durch die um sich greifende
Bildschirmsucht bereitet den Fachleuten Kopfschmerzen.
Zu „Verhältnissen“ und „Verhalten“ kommt im Lehrerberuf noch ein dritter Gesundheitsfak
tor hinzu: die Kunst der Beziehungsgestaltung im Unterricht. Untersuchungen meiner Arbeits
gruppe konnten zeigen, dass es Lehrkräfte die meiste Kraft kostet, im Klassenzimmer eine
Situation herzustellen, in der Lehren und Lernen überhaupt erst beginnen kann. Falls dieses
Bemühen keinen Erfolg hat, ist dies der am stärksten auf die Lehrergesundheit durchschla
gende Einzelfaktor. Das 2007 entwickelte „Lehrercoaching nach dem Freiburger Modell“ ver
sucht daher, die Gesundheit von Lehrkräften durch eine Stärkung der Beziehungskompetenz
zu schützen. Zur Beziehungskompetenz im Lehrerberuf gehört auch die Führungskompetenz
von Schulleitungen. Ein wertschätzender Führungsstil ist für die Gesundheit der Kollegien an
unseren Schulen von überragender Bedeutung.
Ich freue mich über die Vorreiterrolle, die die GEW im Bereich des Arbeits- und Gesund
heitsschutzes seit Jahren einnimmt. Das vorliegende Heft dokumentiert dies erneut in einer
hervorragenden Weise.
Joachim Bauer
Prof. Dr. Joachim Bauer
Neurobiologe, Arzt und
Psychotherapeut