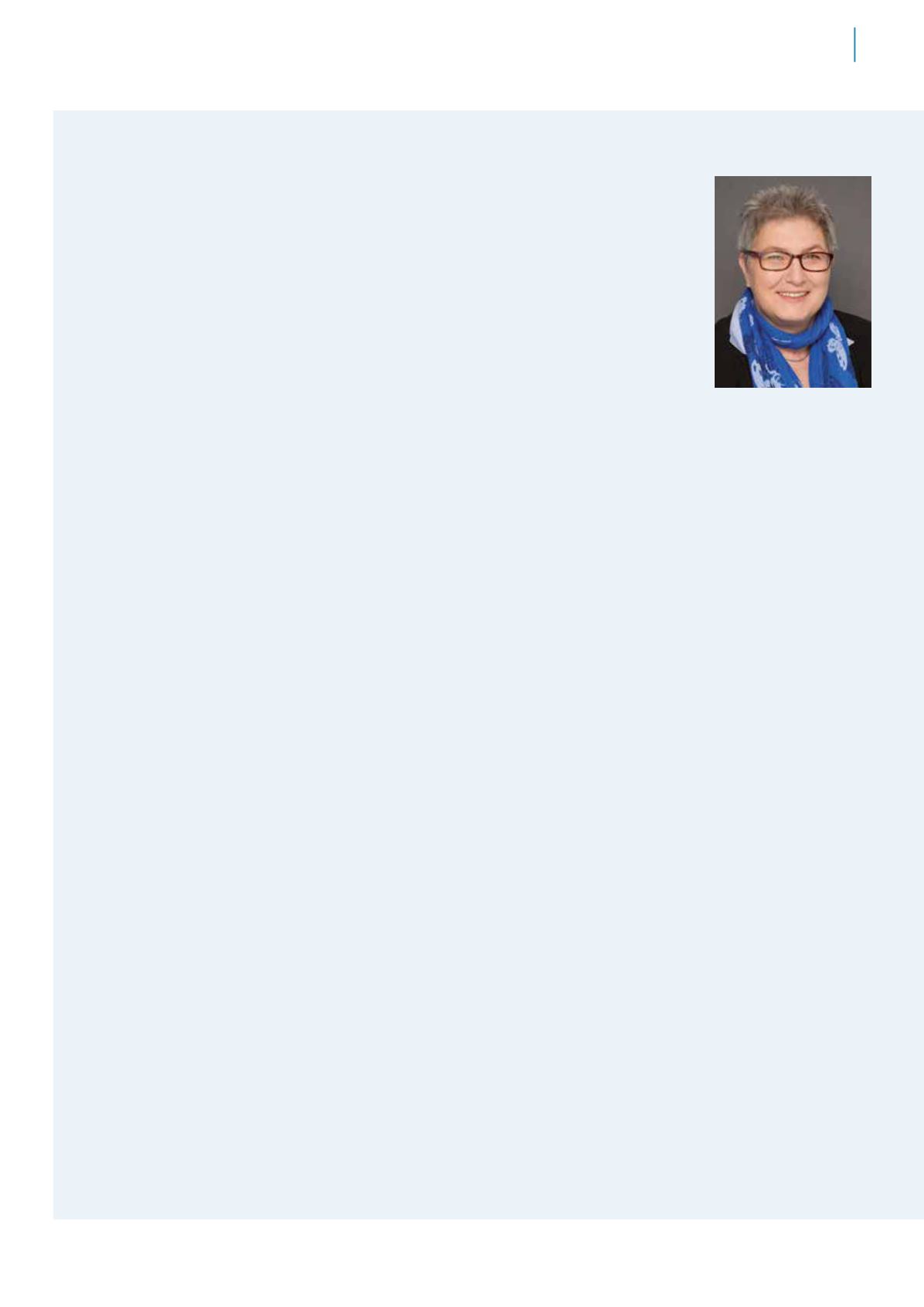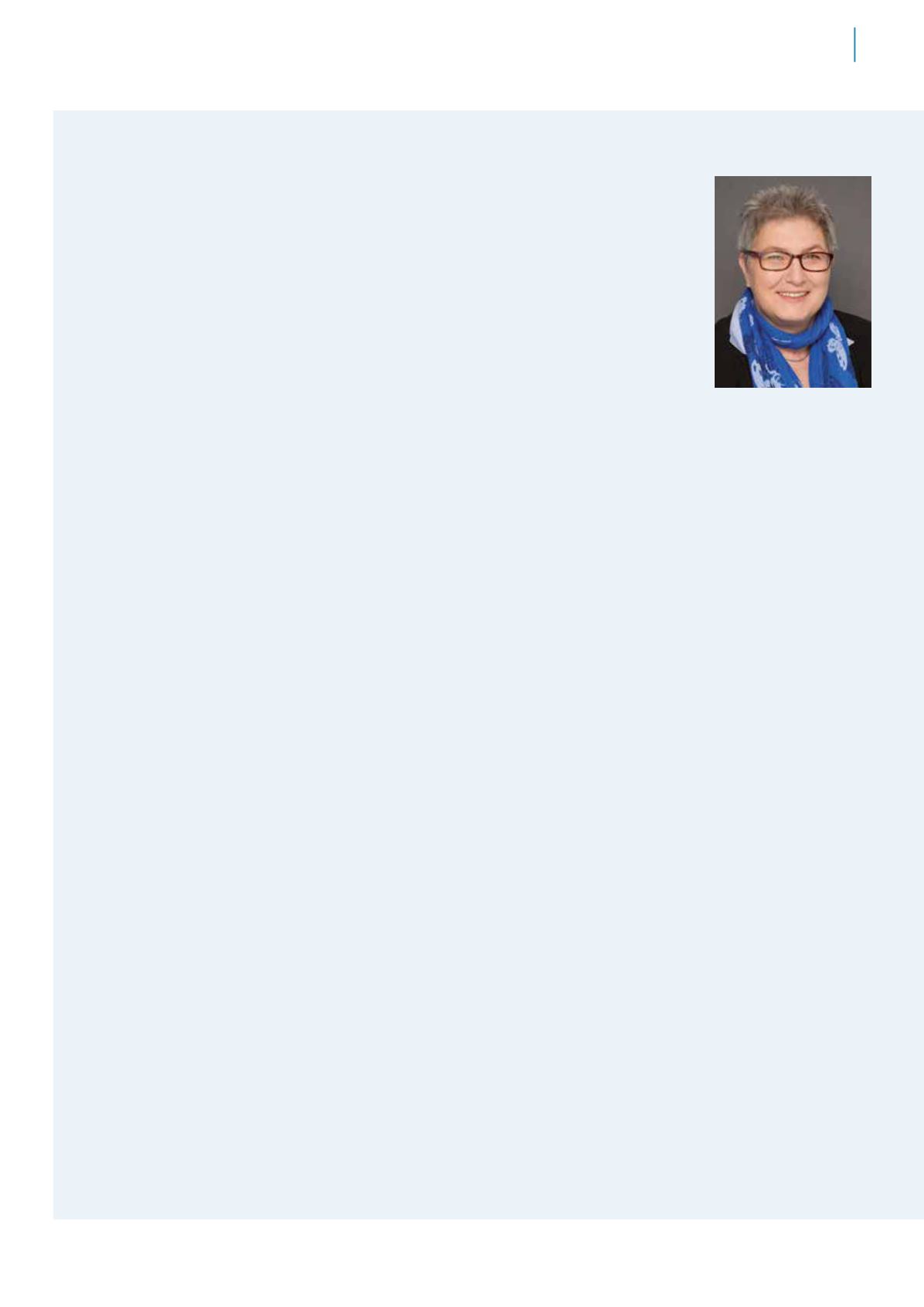
3
nds 11/12-2015
Digitalisierunggestalten
Von neuen Arbeitsformen, der Digitalisierung der Arbeit oder Industrie 4.0 ist inzwischen
täglich die Rede. Dabei wird oft der Eindruck vermittelt, die Digitalisierung bräche über Nacht
herein. Doch so ist das nicht: Sie ist nicht neu, sondern hat schonmit den PCs in den 1970er-
Jahrenbegonnen.Mitdem Internet, derweltweitenVernetzungundneuerRobotikhat inzwischen
einweiterer Schub eingesetzt, der dieArbeitswelt insgesamt erfasst. Jetzt geht es darum, diesen
Wandel zugestalten. Risikenmüssenminimiert, Chancengenutztwerden. DerMenschgehört in
denMittelpunkt, seineArbeitwollenwir erleichternundunterstützen.Dabei dürfenwir nicht nur
fragen, was technischmachbar, sondern vor allemwas sozial wünschenswert ist.
DieBeschäftigten indenMittelpunkt stellen
Wenn sichArbeitsabläufeändern,müssenBeschäftigtepartizipieren. Esgehtdabei umFragen
von Qualifikation undWeiterbildung – die wir als DGB stärken wollen. Es geht aber auch um
(Beschäftigten-)Datenschutz und umArbeitszeit. Wo dieGrenzen zwischenArbeit und Privatem
fließenderwerden, braucht es neueSchutzbestimmungenwieeinRecht auf LogOff. EinigeGroß-
betriebe schalten schon heute ihre E-Mail-Server nach der regulären Arbeitszeit ab, damit ihre
Beschäftigtenauchwirklich Feierabendhaben. DiegesetzlicheArbeitszeit vonacht Stundenam
Tag ist dabei die Belastungsgrenze, die nachwie vor geltenmuss. Gleichzeitigwissenwir aber,
dassdieArbeitnehmerInnenüberdieLage ihrerArbeitszeitenmitbestimmenwollen.Hier ergeben
sichneueChancen für eine bessereVereinbarkeit von Familie undBeruf. Allerdings gibt es auch
neue Risiken, denn wo digital gearbeitet wird, fallen automatisch Daten an. Die vollkommene
Leistungsüberwachung wird damit möglich. Dagegen brauchen wir einen wirksamen Beschäf-
tigtendatenschutz. Entsprechend setzt sichder DGBauf europäischer Ebene ein, woderzeit eine
neueDatenschutzgrundverordnung verhandelt wird.
Arbeit4.0hatnichtnur inderPrivatwirtschaft, sondernauch imöffentlichenDiensterhebliche
Auswirkungen. Die elektronische Akte soll bis 2020 in Bundesbehörden und in vielen Bundes-
ländern Einzug halten. Und auch im Bildungsbereich bringen Smartphone und Tablet Ände-
rungenmit sich. Dabei nutzt fast jeder zweite Beschäftigte im öffentlichenDienst Privatgeräte
für dienstlicheZwecke, hat eineStudiederUniversität Siegenergeben. Viele tundas, um sichdie
Arbeit zu erleichternunddas verlangte Pensum zu schaffen. Undgenaudas ist der Punkt: Ob in
Schulen, in Verwaltungen oder bei der Polizei – es gibt an vielen Stellen zuwenig Personal und
veraltete Technik, während immermehr Aufgaben zu erledigen sind.
Mitbestimmungslücke schließen
Angefangen beim E-Government-Gesetz bis zum Regierungsprogramm „Digitale Verwaltung
2020“–Fakt ist:DasHauptaugenmerkderArbeitgeberundDienstherren liegtstetsauf technischen
StandardsundLeistungsbeschreibungen. FragenzurArbeitsgestaltung, zumGesundheits- undzum
BeschäftigtendatenschutzwerdenbestenfallsamRandeerwähnt. IT-ProjektederVerwaltungwerden
immer öfter von Bund, Ländern und Kommunen im Rahmen des gemeinsamen IT-Planungsrats
gestaltet. Doch sinddieBeschäftigtenda einbezogen? Fehlanzeige! Viel zu spät, erst kurz bevor
die IT-Lösungen in den Dienststellen eingeführt werden sollen, haben Personalräte ein Mitbe-
stimmungsrecht. Immeroffensichtlicher istdieMitbestimmungslücke, diees zu schließengilt.Die
Personalvertretungsgesetze sind zuwenigauf ressortübergreifendeProzessehingestaltet, schon
mit ihrer Einführung hatten die Personalräte weniger Rechte als die Betriebsräte in der freien
Wirtschaft.Deshalb ist esdringenderdenn je:DiePersonalrätebrauchenmehrKompetenzen. Sie
müssen frühzeitigmitbestimmen können, auch wenn es um neue IT geht. Die DGB-Vorschläge
dazu liegen längst auf dem Tisch.
//
ElkeHannack
Stellvertretende Vorsitzende
des DGB